Gerne denkt der Kulturbotschafter des UniWehrsEL zurück an Arthur Millers „Ein Blick von der Brücke“, das im Januar 2025 im Schauspielhaus in Frankfurt Premiere hatte. Der Zweiakter, der unter den italienischstämmigen Einwanderern New Yorks spielt, zeigt die patriarchal geprägte, proletarische Welt von Eddie Carbone. Eine Welt ohne Ausweg zeigt Parallelen zu heutigen Migrationsschicksalen. Miller stellt darüber hinaus Fragen nach Schicksal und Verstrickung, Schuld und Abhängigkeit, die der niederländische Theatermacher Eric de Vrodt in Frankfurt spannend inszenierte. Auch die Thematik der Angst des Mannes vor der Emanzipation der Frau (auch angesprochen im Beitrag zu „Stolz und Vorurteil“ spielt eine Rolle.
Liebe Leser des Blog UniWehrsEL,
Arthur Miller wurde hier im UniWehrsELvon mir im Beitrag zu Gerüchten mit seiner „Hexenjagd“ besprochen. Nicht zuletzt darum möchte ich Ihnen mein Interesse an der Inszenierung von Ein Blick von der Brücke am Schauspiel Frankfurt schildern – was für ein Erlebnis das war! Es ging nicht nur um den puren Verrat – nein, es war ein packender Tanz zwischen zerplatzten Träumen und der Sehnsucht nach einer heilen Welt, die schon längst aus den Händen geglitten ist. Als Zuschauer möchte man dem Hafenarbeiter zurufen: „Ach Eddie!“
Mit einem breiten Grinsen im Gesicht, das kein Regen trüben könnte, stürmte Catherine in die Wohnung. Ihr Bewerbungsgespräch war ein voller Erfolg, und jetzt steht sie kurz davor, eine stolze Stenotypistin zu werden – Klassenbeste noch dazu! Sie wäre nicht nur unabhängig, sondern würde mit ihren stolzen 50 Dollar pro Woche sogar mehr verdienen als du in der staubigen Hafenwelt mit deinen 30 Dollar. Da ist der große Hafenarbeiter plötzlich auf wackeligen Beinen. „Aber komm Eddie, was hält dich zurück? Catherine will die Welt erobern, und du scheinst fest entschlossen, ihr den Schlüssel zur Freiheit nicht auszuhändigen. Warum? Ist es die Angst vor der Veränderung, oder kannst du dir einfach nicht vorstellen, dass die Frauen in deinem Leben mehr Macht und Freiheit genießen könnten als du? Beatrice hängt finanziell von dir ab, Catherine ebenso – aber vielleicht ist es an der Zeit zu erkennen, dass Kontrolle nicht Liebe ist.“ Die Szene wirft doch eine spannende Frage auf: Wer ist hier wirklich der Boss? Sind es die Männer, die meinen, alles lenken zu können, oder sind es die Frauen, die mit einem eleganten Sprung über die Mauern ihrer Begrenzungen nach den Sternen greifen wollen?
Die Regie von Eric de Vrodt: Eine Inszenierung in den 1950er Jahren

Eric de Vrodt entschied, die Handlung von Blick von der Brücke in den 1950er Jahren zu belassen, der Zeit, in der das Stück ursprünglich angesiedelt ist. Diese Entscheidung trägt dazu bei, die historischen und gesellschaftlichen Themen des Werks unverändert zu erhalten. Allerdings gibt es in der Inszenierung keine Sprachbarrieren zwischen Eddie, einem Amerikaner, und den italienischen Einwanderern Marco und Rudolpho. Alle Figuren sprechen fließendes Deutsch, wodurch der Aspekt der Sprachhürde nicht thematisiert wird. Aus heutiger Sicht mag dies unrealistisch erscheinen, doch die Regie verzichtet bewusst auf diese zusätzliche Konfliktebene.
Eddies Haltung gegenüber den Einwanderern ist ebenfalls vielschichtig dargestellt. Er hegt keine allgemeinen Vorurteile gegen die Männer und zeigt sich zunächst aufgeschlossen, indem er sie in sein Haus aufnimmt. Doch sie sollen sich seiner Vorstellung eines idealen Lebens anpassen: harte Arbeit leisten, aber die Frauen in seinem Haushalt respektieren und in Ruhe lassen. Für Eddie sind diese Frauen – Beatrice und Catherine – nicht gleichberechtigte Individuen, sondern Teil seines Besitzes. Seine Beziehung zu Beatrice ist aus heutiger Sicht keine partnerschaftliche auf Augenhöhe, sondern von dominanter Kontrolle geprägt. Eddie bestimmt die Regeln und agiert wie ein mittelalterlicher Fürst, der über seine Festung herrscht.

Die Bühne selbst ist bemerkenswert gestaltet: Sie erinnert an eine Therapiesitzung mit Sitzgelegenheiten, die die Figuren in eine Art Kreis zusammenführt, in dem sie ihre Probleme diskutieren könnten. Dieser Ansatz erzeugt eine spannende Dynamik und eine enge Verbindung zum Publikum. Zuschauer dürfen sogar mit auf der Bühne Platz nehmen, wodurch die Inszenierung nicht nur ein Kammerspiel wird, sondern auch eine aktive Beteiligung des Publikums ermöglicht. Diese offene und intime Atmosphäre verstärkt die Intensität des Stücks und lässt die Konflikte hautnah erlebbar werden.
Die Darstellung der Charaktere
Eddie wird von André Meyer verkörpert, dessen kräftige Statur und imposante Präsenz ihn perfekt für die Rolle machen. Er wirkt wie ein Bär von einem Mann und bringt Eddies Stärke und innereZerrissenheit eindrucksvoll auf die Bühne. Catherine, gespielt von Nina Wolf, wirkt jung und naiv, doch sie zeigt gleichzeitig einen rebellischen Willen, sich gegen die Regeln ihres Onkels durchzusetzen. Für sie scheint es ein Spiel zu sein, Eddies Grenzen auszutesten, während er sich von ihr geschmeichelt fühlt.
Christina Geiße als Beatrice steht vor einer besonderen Herausforderung: Sie erkennt die aufziehenden Konflikte zwischen Nichte, Rudolpho und Eddie und versucht verzweifelt, eine Vermittlerrolle einzunehmen. Beatrice wirkt wie die Stimme der Vernunft in einem Haushalt, der von Spannungen zerrissen wird.
Mrs. Alfieri, gespielt von Heidi Ecks, fungiert als Erzählerin und zugleich als sachliche Ratgeberin von Eddie. Sie ist eine dienbare Unterstützerin, aber auch jemand, der Eddies Handlungen reflektiert und mit juristischem Rat begleitet. Ihr Rat wird schließlich zur Auslöserin von Eddies Verrat an den Migranten.
Autorität und Profit: Eddie im Spannungsfeld zwischen Macht und Kontrolle
Interessanterweise lässt die Inszenierung außer Acht, ob Eddie auch finanziell von den Migranten profitiert, indem er möglicherweise Miete oder Geld für Essen von ihnen verlangt. Dieser Aspekt wird nicht beleuchtet, was den Fokus stärker auf die emotionalen und psychologischen Konflikte legt. Eddie sieht sich selbst als Herr des Hauses, doch die Dynamik zwischen den Figuren zeigt zunehmend die Grenzen seines Einflusses.
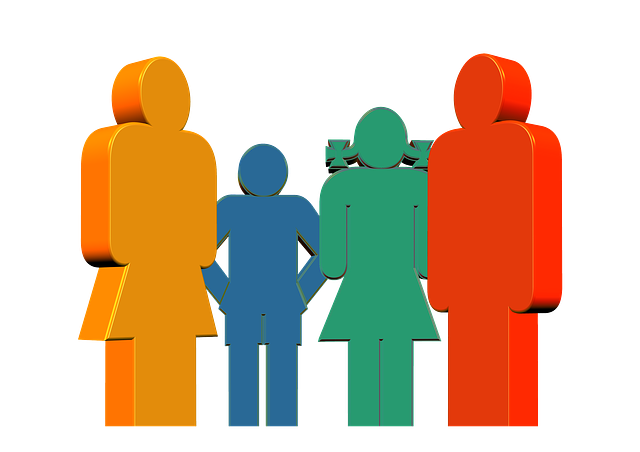
Die traditionelle Vorstellung von Familie und Autorität, wie sie in den 1950er Jahren vorherrschte, wird durch die Handlung und die Darstellung der Charaktere hinterfragt. Die Inszenierung offenbart die Zerrissenheit eines Mannes, der verzweifelt versucht, sein Leben und die Macht über sein Umfeld zu kontrollieren, während ihm die Realität zunehmend entgleitet.

Die Inszenierung von Blick von der Brücke am Schauspiel Frankfurt schafft es, alte Werte und Konflikte in einem frischen, greifbaren Licht zu präsentieren. Es wird deutlich, wie fragile Autorität und festgefahrene Vorstellungen von Macht und Kontrolle Menschen in den Abgrund treiben können. Eddie, der sich als Herr seines Hauses sieht, verliert nach und nach den Boden unter den Füßen – ein Paradebeispiel dafür, wie die Realität oft stärker ist als jede Illusion von Kontrolle.
Die Regie von Eric de Vrodt überzeugt durch ihre Nähe zum Publikum und eine Bühne, die Konflikte hautnah erlebbar macht. Mit starken schauspielerischen Leistungen und einer packenden Dynamik wird die zentrale Frage, wer hier der Boss ist, bis ins Detail ausgelotet. Am Ende bleibt ein bittersüßer Nachgeschmack – eine Erinnerung daran, dass Macht nicht ewig ist und die Sehnsucht nach einer heilen Welt manchmal alles andere als heil zurücklässt. Großes Theater mit Nachhall!
Liebe Grüße vom Kulturbotschafter im Team UniWehrsEL und herzlichen Dank für die begleitenden Bilder von Pixabay!

