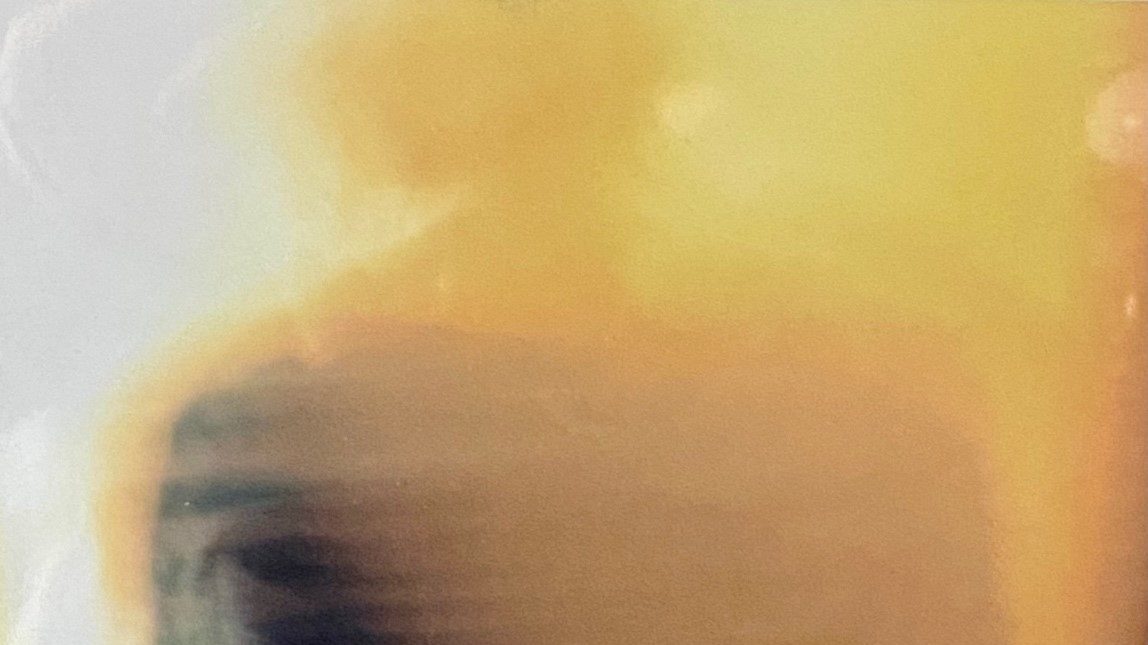Der erste Teil der Recherchen von Heiner Schwens bestätigte die Aussage „Der Suizid trägt die Handschrift des Alters“. Mit zunehmendem Alter steigt das Suizidrisiko in Deutschland deutlich an. Im internationalen Vergleich liegt Deutschland im unteren Mittelfeld . Es wird die Suizidrate pro 100.000 Menschen ausgewertet. Laut Statistischem Bundesland haben bei den G7-Staaten vor allen Dingen die USA und Japan eine deutlich höhere Suizidrate. Italien hat noch eine geringere Rate als Deutschland. Südafrika und die Russische Föderation haben eine sehr hohe Suizidrate (vgl. Experteninterview: Suizidprävention und Krisenintervention Dr. Orzessek, psychologischer Psychotherapeut).
Risikofaktoren reichen von psychischen Erkrankung, Suchterkrankungen, neurologischen Erkrankungen bis hin zur Niereninsuffizienz. Andere Risikofaktoren sind beispielsweise Arbeitslosigkeit, Vereinsamung, kritische Lebensereignisse wie Tod von Angehörigen, Zerwürfnisse in Beziehungen oder traumatische Erfahrungen. Menschen, die bereits einen Suizidversuch vollzogen und deren Lebensprobleme sich nicht abgeschwächt haben, sind besonders suizidgefährdet.
Es gibt manifeste Suizidhandlungen und indirektes Suizidverhalten, das nicht selten verdeckt ist. Zum indirekten Suizidverhalten gehören z. B. Nahrungs- und Medikamentenverweigerung, Missachtung ärztlicher Vorschriften, Unfälle ungeklärter Ursachen. Nahrungs- und Medikamentenverweigerung erlebt man häufig bei Menschen im Alter (dabei ist es egal, ob sie im Heim sind oder Zuhause leben). Ein Grund kann darin liegen, dass „aktive Suizidhandlungen wegen körperlicher Hinfälligkeit und äußerer Kontrolle schwer durchzuführen sind. Da der freiwillige Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit ohnehin ein häufiges Vorkommnis in der dem Sterben vorausgehenden Lebensphase ist, erscheint seine Definition als Suizidhandlung jedoch fragwürdig“. (vgl. Prof. Dr. N. Erlemeier, Prof. Dr. H. Wedler in socialnet.de , Lexikon, veröffentlicht 27.10. 2017)I

In der Altersgruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen machen impulsive Handlungen (Kurzschlusshandlungen) die Mehrheit der Suizid/versuche aus. Ursachen können hier akute Belastungsstörungen sein, z. B. Beziehungsprobleme, Konflikte in der Schule, Aggressionserfahrungen. Jugendliche, die einen Suizidversuch unternommen haben, berichten über Einsamkeitsgefühle und fehlende soziale Ressourcen. Außerdem zeigen homo und bisexuelle Jugendliche eine erhöhte Suizidrate.
Als protektive Faktoren gelten Religiosität, Lebenszufriedenheit, Fähigkeit zur Realitätsüberprüfung, positive Bewältigungsstrategien, dazu zählt auch die Resilienz und soziale Unterstützung und Therapien
Im „Stress-Vulnerabilitätsmodell“ von Wassermann (2001) werden protektive Faktoren als Gegenpol zu den Risikofaktoren beschrieben. Wassermann „schlüsselt im Einzelnen Resilienzmerkmale, kognitive Stile und Persönlichkeitseigenschaften, familiäre Beziehungen, kulturelle und soziale Faktoren sowie positive Umgebungsfaktoren auf“.
Die Kenntnis von Risiko- und Schutzfaktoren stellt eine wichtige Grundlage für Überlegungen zur Suizidprävention dar.
Auch eine Einteilung nach beteiligten Personen kann vorgenommen werden: Doppelsuizid (damit wird die Selbsttötung zweier Personen im gegenseitigen Einverständnis bezeichnet), Massensuizid (vor 26 Jahren nahmen sich 39 Sektenmitglieder in den USA das Leben, um mit einem UFO eine intergalaktische Reise anzutreten; es ist die tragische Geschichte der religiösen Gruppe „Heaven´s Gate), Homizid-Suizid (der Suizident tötet mindesten eine weitere Person ohne deren Einverständnis)
Andere Kriterien können sein: Suizid als Protestaktion und politisches Mittel (Hungerstreik), Kamikaze (Japanische Soldaten z. B. im zweiten Weltkrieg), Erpressungssuizid, Assistierter Suizid (Beihilfe zur Selbsttötung); Suizid nach dem Werther-Effekt (nach der Veröffentlichung von Goethes Roman “Die Leiden des jungen Werthers“ im Jahr 1774 kam es zu einer Erhöhung der Suizidrate). Für Interessierte: Im Gegensatz zum Werther-Effekt steht der „Papageno-Effekt“. Der Begriff stammt von der Figur Papageno aus Mozarts Oper „Die Zauberflöte“. Papageno konnte hier seine Suizidgedanken mit Hilfe anderer überwinden.
Das Bundesgesundheitsministerium hat im Frühjahr eine Nationale Suizidpräventionsstrategie vorgelegt. Primäres Ziel ist, mit den verfügbaren, grundsätzlich begrenzten Ressourcen, eine möglichst große Reduktion der Zahl der Suizide zu erreichen. Bei der Strategie geht es um drei Handlungsfelder: sind Gesundheitskompetenz und psychosoziale Beratung. Bedeutend sind Vernetzung und Koordination, wenn man die Prävention umfassend angehen will. Die Strategie schlägt vor, eine nationale Kompetenz- und Koordinierungsstelle einzurichten. Dies ist deshalb sinnvoll, weil die Zuständigkeiten im Bereich Suizidprävention sich über den Bund, die Länder und die Kommunen erstrecken. Es soll auch eine Betroffenen-Beteiligung geben, ebenso soll auch die Forschung und Evaluation entsprechend berücksichtigt werden.
Der größtmögliche Präventionseffekt wird erzielt u. a.
- Durch Maßnahmen, die sich auf Hochrisikogruppen konzentrieren
Maßnahmen können Awareness-, (Aufmerksamkeit und Bewusstsein für eine Problematik soll erreicht werden), Aufklärungs- und Entstigmatisierungskampagnen sein, die vor allem Männer, die 70% aller Suizide begehen, und alte Menschen erreichen sollen. Erreichbar sein können sie in Arztpraxen, Krankenhäusern (sozialer Dienst), geriatrischen Einrichtungen, Seniorentreffs, palliativmedizinische Angebote und Hospize, sowie über das klassische Fernsehen, Zeitungen und Zeitschriften.
Die Versorgung suizidgefährdeter psychisch kranker Menschen soll durch eine Verbesserung der psychiatrischen und psychotherapeutischen Versorgung der Bevölkerung erreicht werden. Nach einem Suizidversuch sollte diese Hochrisikogruppe in eine längerfristige suizidpräventive Betreuung überführt werden.
- Durch evidenzbasierte (wissenschaftliche belegte) Maßnahmen
Wissenschaftlich belegte Untersuchungen haben gezeigt, dass Awareness Programme in Schulen zu einer Reduktion von Suizidversuchen und Suizidgedanken geführt haben. Die Verordnung der psychiatrischen Medikamente Litium und Clozapin, nicht aber die Verordnung von Antidepressiva, zeigen einen antisuizidalen Effekt.
Auch die sog. Methodenrestriktion nimmt einen hohen Stellenwert hinsichtlich der gegenwärtigen Verfügbarkeit oder Nichtverfügbarkeit einer Suizidgelegenheit ein. So konnte in Ländern mit einer hohen Verfügbarkeit von Schusswaffen ein suizidpräventiver Effekt durch die Einschränkung des Zugangserreicht werden. Da die Wissenschaft gezeigt hat, dass sog. Hotspots häufig für Suizide genutzt werden, dazu zählen Hochhäuser, Brücken, Bahnübergänge. Durch Zugangsbeschränkungen oder zusätzlicher Sicherungsmaßnahmen konnte die Suizidrate gesenkt werden, ohne dass sie durch Ausweichen auf andere Orte ausgeglichen wurde.
Schaffung eines deutschlandweiten Suizidregisters mit pseudonymisierten Daten, die wissenschaftlich ausgewertet werden können. Darüber könnten neue Risikogruppen möglichst rasch erkennbar sein, außerdem können methodenbegrenzte Maßnahmen abgeleitet werden.

Es muss ein durchgehend erreichbarer Krisendienst für Menschen in seelischer Not geschaffen werden, der eine fachkompetente Sofortberatung garantiert und, in eingeschränktem Maße, auch ein Vor-Ort-Besuch ermöglicht.
Dieses Angebot sollte unter einer bundesweit einheitlichen Notrufnummer sowie online erreichbar sein. Hilfe – Telefon 0800 – 1110111
Am 10. September 2025 ist der Welttag der Suizidprävention. Er wurde eingerichtet, um die Öffentlichkeit auf „die weitgehend verdrängte Problematik der Suizidalität“ aufmerksam zu machen. Das erste Mal wurde dieser Welttag von der WHO am 10. September 2003 ausgerufen.
Danke lieber Heiner Schwens, auch für das wunderbare Bild einer verschwommenen Rückenansicht einer Frau, dies scheint die Thematik des „sich zum Verschwinden-Bringens“ aufzugreifen! Dieser Beitrag findet seine Fortsetzung in einem Teil 3!