In Georges Bizets Oper Carmen singt man von der Liebe als einem Vogel mit bunten Flügeln, der schwer zu fangen ist. Ein Symbol für die Flüchtigkeit und Magie dieses Gefühls, aber auch für seine unberechenbare Natur. Doch manchmal wird Liebe als Blindheit beschrieben – eine überwältigende Emotion, die die Sicht auf die Realität vernebelt. Vielleicht denkt der Leser an „Hoffmann„, der in einer seiner Erzählungen eine „Brille der Liebe“ aufsetzt, nur um später zu erkennen, dass seine geliebte Frau ein mechanischer Automat ist. Oder an Tschaikowskys Iolanta, die in ihrer Blindheit das Licht der Liebe sucht. Diese metaphorischen Verblendungen lassen sich auf Jenny Erpenbecks Roman Kairos übertragen. Die Geschichte von Hans und Katharina zeigt, wie eine Liebe zerstörerisch wirken kann, wenn sie sich zur Macht und Kontrolle wandelt. Zugleich wird sie zum Sinnbild der abgeschlossenen Welt der DDR.
Die Blindheit der Liebenden: Iolanta, Hans und Katharina
Die Figuren Hans und Katharina sind selbst eine Art „Iolanta“. Sie leben zunächst in ihrer abgeschlossenen Welt der Liebe und sehen die Realität nicht mehr klar. Hans, der 34 Jahre älter ist, hält Vorträge, die seinen Sohn langweilen, doch Katharina glaubt, dass sie mit ihm nie Langeweile erleben wird. Sie blendet seine Fehler aus – seinen Zynismus, seine pragmatischen Anpassungen an das Leben und später sogar seine brutalen Machtspiele, als er ihren „Betrug“ mit einem jüngeren Mann entdeckt hat. Doch wie Iolanta, die in ihrer Blindheit ihre Umwelt nicht erkennen kann, entwickeln sich Hans und Katharina zu Gefangenen ihrer eigenen Beziehung.

Hans‘ Liebe entpuppt sich als destruktives Machtspiel. Sein Kontrollzwang zwingt Katharina in eine Rolle der völligen Abhängigkeit. Sie soll ihm alle Geheimnisse offenlegen; keine privaten Briefe, keine eigenen Notizen, kein eigenständiges Leben. Dieses Vorgehen erinnert an Hoffmanns „Brille der Liebe“, die anfänglich alles verschönert, nur um letztendlich die grausame Realität, einer Puppe verfallen zu sein, offenbaren zu müssen. Auch Katharinas Naivität gegenüber Hans‘ manipulativer Natur wird als eine Form der Blindheit dargestellt, die sie daran hindert, sich aus seiner Kontrolle zu befreien.
Der Kontrollzwang von Hans als Metapher für die DDR
Hans‘ Kontrollzwang gegenüber Katharina ist nicht nur eine zerstörerische Dynamik innerhalb der Beziehung, sondern auch eine treffende Metapher für das politische System der DDR. So wie Hans Katharinas Eigenständigkeit unterbindet und sie in eine Rolle der völligen Abhängigkeit zwingt, schränkte die DDR ihre Bürger immer mehr ein. Die einstigen Hoffnungen und Euphorien nach dem Zweiten Weltkrieg, ein neues, gerechteres Deutschland aufzubauen, wandelten sich in ein System der Kontrolle und des Misstrauens.
Hans verkörpert die DDR, die ihre Bürger wie Besitz behandelt und jeden Versuch der Eigenständigkeit mit Repression beantwortet. Sein Zynismus und die Flucht in Literatur und Kunst spiegeln die Anpassungsstrategien wider, die viele DDR-Bürger entwickelt haben, um mit der Restriktion ihrer Freiheit zurechtzukommen. Die Beziehung zwischen Hans und Katharina wird zur Parabel für die erstickende Dynamik eines Systems, das Angst vor Verlust und Veränderung hat. Diese Angst – sei es die Angst, Katharina zu verlieren oder die Angst der DDR vor der Öffnung und dem Zerfall – führt letztlich zur Selbstzerstörung.
Die DDR als Parabel für Liebe und Kontrolle
Die politische und zeitgeschichtliche Kulisse von Kairos gibt der Liebesgeschichte eine zusätzliche Dimension. Während Hans und Katharina in ihrer emotionalen Blindheit gefangen sind, erleben sie große gesellschaftliche Umwälzungen: Von der Wahl des Volkskongresses am 7. Mai 1989, bei der Katharina alle Kandidaten durchstreicht, bis zum Fall der Mauer im November desselben Jahres. Die DDR öffnet sich nach und nach; Ungarn hebt seine Grenzkontrollen auf, und die Bevölkerung strömt nach Westen – doch Hans und Katharina holen sich das Begrüßungsgeld nicht ab.
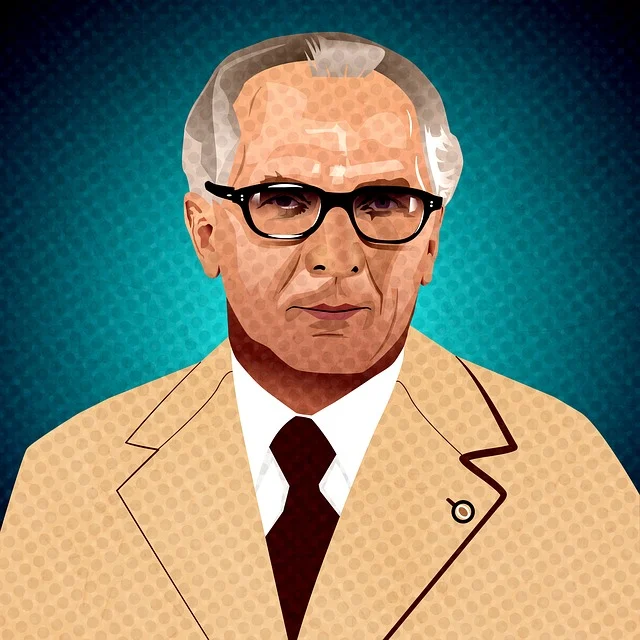
Erwähnungen von historischen Persönlichkeiten wie Gorbatschow sowie Ereignisse wie die Milliardenkredite, die Honecker zum Überleben der DDR benötigt, unterstreichen den Kontext. Hans schreibt einen Text für das Programmheft Lohndrücker von Heiner Müller, und Katharina besucht ein Punk-Rock-Konzert in der Zionskirche, das von Neonazis gestürmt wird. Diese Szenen verweben die Liebesgeschichte mit der DDR-Historie und zeigen, wie das geschlossene, kontrollierte System der DDR zunehmend ins Wanken gerät. Auch die stumme, bedrückende Atmosphäre zwischen Hans und Katharina spiegelt die untergehende DDR wider – ein System, das in Kontrolle und Angst vor Veränderung gefangen ist, ähnlich wie Hans in seiner Beziehung zu Katharina.
Fazit: Liebe und Kontrolle in Politik und Emotion
Die Geschichte zwischen Hans und Katharina endet tragisch, letzten Endes nicht zuletzt dadurch, dass Hans mit dem Verlauf seiner Liebesgeschichte auch noch einmal seine bisherige politische Biographie vom systemgläubigen Hitlerjungen, über den inoffiziellen Stasimitarbeiter wiederholt. Er wird zum sie demütigenden „Machthaber“, weil eingetreten ist, was er von Anfang an befürchtet hat, „in diesen jungen Augen ein alter Mann zu sein.“
Kairos zeigt eindrucksvoll, dass Liebe sowohl erfüllend als auch zerstörerisch sein kann. Hans und Katharina leben in einer eigenen kleinen Welt, ähnlich wie die DDR mit ihrer abgeschlossenen Politik und ihrem Misstrauen gegenüber Veränderung. Die Blindheit der Liebe wird in Erpenbecks Roman nicht nur als emotionales Phänomen, sondern auch als Spiegel gesellschaftlicher und politischer Entwicklungen dargestellt.
Am Ende bleibt die Frage offen: Ist diese Blindheit der Liebe immer schädlich – oder kann sie uns vielleicht auch manchmal helfen, die rauen Kanten des Lebens zu glätten? Die Mischung aus persönlichen Abgründen und zeitgeschichtlichen Entwicklungen macht Kairos zu einer vielschichtigen Parabel über Macht, Kontrolle und die Illusion von Freiheit. Was denken die Leser über die Verbindung von Liebe, Macht und politischer Restriktion – sind diese Dynamiken ein unvermeidlicher Teil menschlicher Beziehungen und Systeme?
Herzlichen Dank, lieber Kulturbotschafter des UniWehrsEL. Gemeinsam wollen wir in Teil 4 nochmals einige Grundfragen zu „Wahr oder Lüge“ zusammenfassen.

