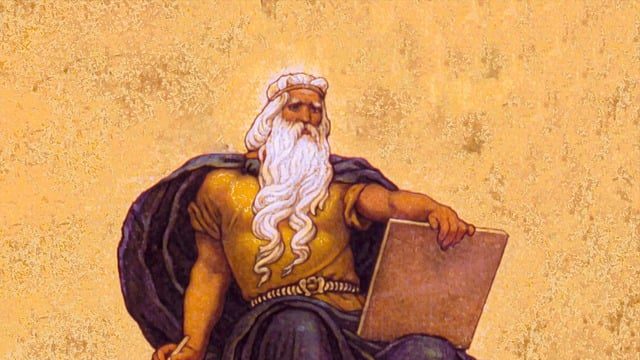Um über die verheerende Wirkung von Halbwahrheiten zu sprechen, möchte der Rezensent als Beispiel die Netflix-Serie Kaos von 2024 heranziehen. Diese Serie, die moderne Geschichten mit antiken griechischen Mythen vermischt, zeigt auf eindrucksvolle Weise, wie Halbwahrheiten zu Chaos führen können. Die Serie Kaos dreht sich um die Götter des Olymp, die in der modernen Welt leben und mit den Problemen der Sterblichen konfrontiert sind. In einer Welt, in der die Wahrheit oft vernebelt und Halbwahrheiten verbreitet werden, müssen die Charaktere navigieren und entscheiden, wem sie vertrauen können. Jeder Versuch, die Wahrheit zu verschleiern oder nur teilweise preiszugeben, führt zu Missverständnissen, Konflikten und letztendlich zu Chaos. Halbwahrheiten sind oft gefährlicher als vollständige Lügen. Sie bieten einen Anschein von Wahrheit und Verlässlichkeit, aber ihre fehlenden Details und Verzerrungen können entscheidende Informationen verbergen und die Wahrnehmung der Realität verzerren. Dies kann weitreichende Konsequenzen haben, wie die Serie Kaos zeigt. Dazu ein Beitrag vom Kulturbotschafter des UniWehrsEL, mit großem Dank!
Liebe UniWehrsEL-Leser,
die Serie Kaos verdeutlicht auf unterhaltsame Weise, wie wichtig es ist, sich um die vollständige Wahrheit zu bemühen und vorsichtig mit Informationen umzugehen. Nur so können wir sicherstellen, dass unsere Entscheidungen auf soliden und vertrauenswürdigen Grundlagen beruhen und nicht im Chaos enden.
Ein besonders anschauliches Beispiel für die Folgen von Halbwahrheiten bietet der Mythos von „Orpheus und Eurydike“, den bereits Gluck zu einer Oper verarbeitet hat. Orpheus ist aber auch der Titelheld in der Netflix-Serie Kaos. Orpheus, ein begnadeter Musiker, verliert seine geliebte Eurydike durch einen Schlangenbiss. Voller Trauer steigt er in die Unterwelt hinab, um sie zurückzugewinnen. Durch seine herzzerreißende Musik überzeugt er Hades, den Gott der Unterwelt, ihm Eurydike zurückzugeben – jedoch unter einer Bedingung: Orpheus darf sich auf dem Rückweg nicht umdrehen und muss darauf vertrauen, dass Eurydike ihm folgt.
Dieser Mythos verdeutlicht die Gefahr von Halbwahrheiten. Orpheus erhält eine nur teilweise Wahrheit: Eurydike wird ihm zurückgegeben, unter der Bedingung, sich nicht umzudrehen, aber warum, das wird ihm verheimlicht und führt zu Unsicherheit und den Zweifeln, die ihn schließlich überwältigen. Im entscheidenden Moment verliert Orpheus das Vertrauen, alles wird schon gut gehen, und dreht sich um, nur um zu sehen, wie Eurydike durch sein Misstrauen für immer in die Unterwelt zurückgezogen wird.
Orpheus und Eurydike im Staatstheater Darmstadt
Als Freund der griechischen Mythologie habe ich einen besonderen Trip unternommen. Im Staatstheater Darmstadt sah ich „Orpheus und Eurydike“ von Gluck. Es ist die weltberühmte Liebesgeschichte über den in der Antike berühmten Sänger Orpheus, dessen Lieder die Herzen von Menschen und Göttern gleichermaßen berührten, er liebte die wunderschöne Eurydike über alles. Ihre Liebe war rein und intensiv, und sie heirateten in einer feierlichen Zeremonie. Doch das Glück war nur von kurzer Dauer. Eurydike wird von einer Schlange gebissen und stirbt, was Orpheus in tiefste Verzweiflung stürzt.

Mit diesem Schmerz beginnt die Oper. Sein Schmerz ist so groß, dass er beschließt, in die Unterwelt hinabzusteigen, um seine geliebte Frau zurückzuholen. Als Mitstreiter gewinnt Orpheus die Liebesgöttin Amor. Sie teilt ihm mit, dass es dem Sänger von dem Göttervater Zeus erlaubt worden ist, den Abstieg in den Hades zu wagen, wenn es ihm gelingt die Furien (Wächter über die Toten) mit seinem Gesang zu rühren.
Nach Zeus‘ Willen darf er Eurydike aus der Unterwelt mitnehmen, unter einer Bedingung: Er dürfe sich nicht nach ihr umdrehen, bevor sie gemeinsam die Oberwelt erreicht haben. Tatsächlich gelingt es Orpheus mit seiner Hartnäckigkeit die Furien zu überwinden. Er darf nun das Elysium beteten. Da erscheint Eurydike unter den Klängen seiner Musik. Wie von Amor befohlen, nimmt er sie bei der Hand und führt sie eiligen Schrittes hinaus.
Der Weg zurück ist lang und in dieser Version hat Eurydike Zweifel an den Motiven von Orpheus. Es gelingt ihm nicht, Eurydike zu beruhigen, und so macht er einen fatalen Fehler. Er hat nun seinerseits Zweifel daran, ob sie ihm folgt und dreht sich nach ihr um, entgegen der Bedingung von Zeus. Damit verliert Orpheus seine Geliebte scheinbar für immer. Er will sich erstechen. In der Fassung von Gluck gibt es ein Happyend für die Liebe. Amor verhindert, dass Orpheus sich umbringt, und Eurydike wird von Amor zum Leben wiedererweckt.
Die erste Oper über den Mythos von Orpheus hatte bereits 1609 der Komponist Monteverdi vertont. Glucks Oper entstand 150 Jahre später. Das Thema über einen Sänger, der die Menschen anrühren kann und den Tod seiner geliebten Frau nicht akzeptieren kann, ist ein beliebtes Motiv.
In der Inszenierung von Soren Schumacher geht es um den inneren Kampf, den Orpheus mit sich selbst austrägt. Deshalb hat die Regie eine Gegenfigur zur positiv gestimmten Figur des Amors in die Oper eingeführt. Diese zusätzlich erdachte Figur heißt laut Programmheft „Mort/Psyche“. Sodass in der Inszenierung zwei Gegenpole wie Engel und Teufel aufeinandertreffen. Amor will Liebe stiften. Mort/Psyche will, dass Orpheus Trip in die Unterwelt ein Fiasko wird.
Die Regie, die die Oper unter dem Blickwinkel der Psychologie betrachtet kann, konstatiert, Orpheus kann nach dem von ihm Erlebten nicht einfach am Ende glücklich weiterleben, als wäre nichts gewesen. Das von Gluck hinzugefügte glückliche Happyend empfindet die Regie also als unrealistische Option und verwirft sie deshalb. Gedanklich knüpft Schuhmacher also an Monteverdis trauriges Ende mit einem verzweifelten Orpheus an. Amor feiert bei Schuhmacher die Liebe allein. Amor wirkt, wie eine Politikerin oder eine Lobbyistin, welche die wahre Liebe propagiert, obwohl die Helden der Geschichte, Orpheus und Eurydike, bereits tot sind und nur noch ihre Legende von Amor mit Happyend weitergetragen wird.
Die Handlung wird in „Kaos“ in die Gegenwart verlegt
Wie bereits Eingang erwähnt, ist die Geschichte von Orpheus und Eurydike auch heute noch sehr populär. So hatte nicht nur das Staatstheater Darmstadt die Idee, den Stoff von Orpheus und seiner geliebten Eurydike neu zu deuten, sondern auch der Streamingdienst Netflix hat die Storyline für eine Serie „Kaos“ 2024 verwendet. Diese Serie verlegt die Handlung in die heutige Zeit, aber an einen fiktives Setting. Das ist besonders aufschlussreich. Zudem bedient sich die Serie des Stilmittels der Ironie. Die Serie firmiert, anders als es die Oper dies tut nicht als Drama, sondern als Comedy. Der Grad zwischen Tragödie und Komödie ist fließend, wie der Kenner weiß.

Ausgerechnet Zeus der Göttervater wird in dieser Satire von Jeff Goldblum gespielt. Vielen Kinogängern ist der Schauspieler Jeff Goldblum durch seine Rolle als Vertreter der Chaostheorie – was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen, im ersten Film „Jurassic Park“ aus den 1990ern in bester Erinnerung. Nicht zu verwechseln mit den Neuverfilmungen, die mehr auf große Monster-Saurier setzen, als auf eine inhaltliche Grundlage für einen spanenden Film.
Dieser dauernörgelnde Typ oder Oberkritiker des Kapitalismus – wie kann man Dinos erschaffen für einen Freizeitpark, damit ein alter Millionär ein neues Spielzeug hat – spielt in „Kaos“ nun den selbstgefälligen, leicht korrupten Kapitalisten bzw. Göttervater. Die Götter sind in Kaos eine gutsituierte Oberschicht, die nur noch mit sich selbst beschäftigt ist. Um die Belange der Menschen kümmern sich Zeus und seine Gemahlin Hera schon lange nicht mehr. Zeus geht es nur noch um sich selbst. Jeff Goldblum interpretiert Zeus als Egoisten.
Dieser Zeus hat Angst vor Veränderung. Orpheus ist in Kaos ein selbstverliebter Sänger. Er kümmert sich gerade um seinen nächsten Hit und seine Promotion. Für Eurydike hat er keine Zeit. Diese fühlt sich vernachlässigt. Sie plant diesen egoistischen Partner zu verlassen, ohne es ihm direkt mitzuteilen. Am Ende der ersten Folge wird Eurydike von einem Auto überfahren.
In „Kaos“ ist das Elysium in grauen Farben gehalten. Ganz anders als die grellen, bunten Farben im Olymp oder auf der Erde. Riddy darf sich in diesem kapitalistisch-geprägten Elysium nicht etwa faul auf die Haut legen oder glücklich in der Sonne liegen. Riddy wird zum Arbeitsdient im Elysium eingeteilt. Als Oberaufseher fungiert eine weitere bekannte Figur aus der griechischen Mythologie namens „Medusa“. Zur Erinnerung: Medusa mit dem Schlangenkopf wurde getötet und ist ebenfalls im Elysium gelandet, um den Arbeiterinnen das Leben zur Hölle zu machen.
Riddy ist in einer Art Gefängnis mit Wäscherei untergebracht, weil Riddy böse Gedanken hatte, darf sie nicht in den Himmel, sondern muss ins kapitalistische Arbeitslager. Nachdem Orpheus endlich bemerkt hat, dass Riddy tot ist, davor war er mit seinem Ruhm beschäftigt, muss er in eine Karaokebar. Diese ist das Tor zur Unterwelt. Statt der Göttin Amor – wer glaubt heutzutage noch an die ewige Liebe – bekommt Orpheus als Sidekick den Gott „Dionysos“ zur Seite gestellt. Dionysos ist zur Erinnerung der Gott des Weins oder in der Adaption der Gott der Partys. Da Zeus seinen Sohn Dionysos nicht ernst nimmt, überlegt Dionysos etwas zu tun, was die Aufmerksamkeit seines Vaters erregt. Er ist also auch selbstverliebt wie Zeus und Orpheus.
Dionysos bringt Orpheus also in die Kneipe. Um seinen Vater zu ärgern, nicht weil er Orpheus traurige Geschichte mitempfindet, sondern nur um seinen Vater eins auszuwischen. In der Kneipe öffnet sich ein Tor und Orpheus darf in die Unterwelt.
Ob es diesem neuen Orpheus gelingt Riddy aus dem Arbeitslager im Elysium zu befreien, soll an dieser Stelle nicht verraten werden. Die Storyline von Orpheus und Riddy wird am Ende der ersten Staffel aufgelöst. Für eine zweite Staffel hat es dann doch nicht gereicht, so endet die Serie ohne Happyend und kommt damit der Inszenierung des Staatstheaters Darmstadt gefährlich nahe, die auch keinen glücklichen Schluss haben wollte. Es besteht bei dem Kunstschaffenden gerade offenkundig das Bedürfnis, den Untergang zu inszenieren nicht das glückliche Ende.
Fazit: Die Macht der Halbwahrheiten in „Orpheus und Eurydike“ sowie „Kaos“
Halbwahrheiten können, wie die Geschichten von „Orpheus und Eurydike“ sowie die moderne Adaption „Kaos“ zeigen, gravierende Auswirkungen haben. In Glucks Oper „Orpheus und Eurydike“ führt die unvollständige Wahrheit über die Bedingung, sich nicht umzudrehen, zu einem tragischen Verlust. Orpheus‘ Misstrauen und Eurydikes Zweifel verstärken die Bedeutung von vollständigen und klaren Informationen in entscheidenden Momenten.
Die Serie Kaos greift diesen Mythos in einem modernen, satirischen Setting auf und zeigt, wie Halbwahrheiten und fehlende Kommunikation auch in der heutigen Zeit zu Chaos führen können. Die Selbstverliebtheit und Unachtsamkeit der Charaktere unterstreichen die Gefahr, die von unvollständigen Informationen ausgeht.
Beide Werke verdeutlichen, dass Halbwahrheiten nicht nur Missverständnisse und Konflikte hervorrufen, sondern auch weitreichende und oft tragische Konsequenzen nach sich ziehen können. Nur durch vollständige und klare Kommunikation können wir sicherstellen, dass unsere Entscheidungen auf soliden und vertrauenswürdigen Grundlagen beruhen und somit das Chaos vermeiden.
Ich freue mich über Ihre Meinung, Ihr Kulturbotschafter des UniWehrsEL