Die Figur der Iris im Beitrag zur Filmkritik „Companion – die perfekte Begleitung“ hat zu weiter führenden Überlegungen geführt. Die berühmte Puppe aus Squid Game treibt 2025 wieder ihr Unwesen auf Netflix. Denn die Serie „Squid Game“ bekommt eine zweite und dritte Staffel. Dazu nun Gedanken des Kulturbotschafters des UniWehrsEL zu der geheimnisvollen Puppe. Sie ist kein bloßes Requisit, sondern ein vielschichtiges Symbol: mechanisierte Unschuld trifft auf tödliche Bürokratie. Ihr kindliches Aussehen — Zöpfe, naive Gesichtszüge — evoziert Schutz und Verletzlichkeit; zugleich macht ihre starre, kalte Mechanik sie zur instrumentellen Durchsetzerin von Regeln, die über Leben und Tod entscheiden. Der singende Refrain „Rotes Licht, grünes Licht“ verwandelt klare Anweisungen in ein einlullendes Ritual, das Gehorsam fordert und zugleich in grotesker Weise verharmlost, was auf dem Spiel steht. Die Puppe repräsentiert die Entmenschlichung des Systems: Hier wird Kontrolle infantil verpackt, damit sie leichter akzeptiert wird.
Liebe Leser des UniWehrsEL,
Als Symbol des Kapitalismus steht sie für die automatisierten, unbarmherzigen Forderungen, die Individuen täglich auferlegt werden — Leistungskennzahlen, Fristen, Beobachtung durch Kameras. Wer die Vorgaben nicht erfüllt, wird „disqualifiziert“; das entspricht im tatsächlichen Arbeitsleben dem Verlust von Arbeitsplatz, Status und Sicherheit. Dass die Puppe einem Mädchen ähnelt, betont die Zynik: die Oberfläche wirkt harmlos, die Konsequenz ist brutal. Die Figur stellt auch die Ambivalenz von Technik dar: Fortschritt und Präzision können zugleich Schutz und Unterdrückung bedeuten, je nachdem, wer die Maschine steuert.
Vor diesem Hintergrund legt die folgende Leserbrief-Analyse der Serie Squid Game dar, wie die Puppe als Zentrum einer Kritik an Wettbewerb, Ungleichheit, Schuldenfallen und neoliberaler Rhetorik fungiert — und wie die Spiele die Strukturen realer Bewerbungsverfahren und Arbeitsbedingungen spiegeln.

Die berühmte Puppe aus Squid Game — mit ihrem singenden, kindlich-befremdlichen Refrain „Rotes Licht, grünes Licht“ — ist zu einer Ikone der Serie geworden. Sie steht, still und starr, als mechanische Verkörperung eines Spiels, in dem Sekunden über Leben und Tod entscheiden. Die Spieler müssen ungesehen an ihr vorbeikommen; wer sich bewegt, wenn sie sich umdreht, oder die eng gesetzte Frist (getaktete Zeitvorgabe) nicht einhält, wird disqualifiziert. Diese Szenerie ist so simpel wie brutal: Menschen fliegen wie Fliegen aus dem Feld. Die nüchterne, kalte Effizienz der Puppe — ein Roboter, der einem kleinen Mädchen nachempfunden ist, mit glatter Kunststoffhaut, starren Gliedern und großen, unbewegten Augen — macht den Schrecken komplett. Sie wirkt zugleich unschuldig und unbarmherzig, ihr Singsang verwandelt tödliche Regeln in Kinderlied.
Die Spiele funktionieren wie ein raffiniertes Bewerbungsverfahren: viele Kandidaten, eine einzige Belohnung. Nur ein Bewerber bekommt den Job — oder in Squid Game: nur einer das Preisgeld. In beiden Fällen entscheidet sich das Leben Vieler an dem Erfolg Einzelner. Doch während ein reales Auswahlverfahren normalerweise auf Leistung, Kompetenz und Fairness hoffen lässt, treibt die Serie dieses Prinzip auf die Spitze: Hier gibt es eine Waffe, hier wird mit Leben gezahlt. Im Kapitalismus mag die Drohung nicht so explizit sein, aber die Logik ist ähnlich: Wer die Vorgaben nicht erfüllt, verliert seine Stellung — nicht immer sofort sein Leben, aber oft Existenzgrundlage, soziale Teilhabe und Würde. Disqualifikation im Unternehmen heißt oft Arbeitsplatzverlust, Pleite, Isolation. Die Zeitvorgaben im Game, die starren Regeln vor der Puppe, erinnern an tägliche Arbeitsziele, an Leistungsdruck, an das gnadenlose Ticken der Uhr im Angestelltenleben.
Die Serie unterstreicht diese Parallele deutlich: ein Spiel zwischen Leben und Tod, geprägt von Gewalt, Überlebenskampf und der Kritik am Kapitalismus. Die Kandidaten sind häufig verschuldet, verzweifelt — Spielsucht, Hypotheken, Behandlungs- oder Unterhaltskosten treiben sie in die Arena. Das hohe Preisgeld von 45 Millionen Won ist die Karotte, die sie gefangen hält: es ist nicht für die Gemeinschaft gedacht, sondern für einen Einzelnen — ein symbolischer Jackpot, der die Ungleichheit verstärkt.Gerade die Spielsucht, die Menschen in Abhängigkeit und Schulden stürzt, macht die Entscheidung, teilzunehmen, beinahe zwingend. Das Spiel erscheint nur scheinbar freiwillig; realer ökonomischer Druck erzwingt die Teilnahme.

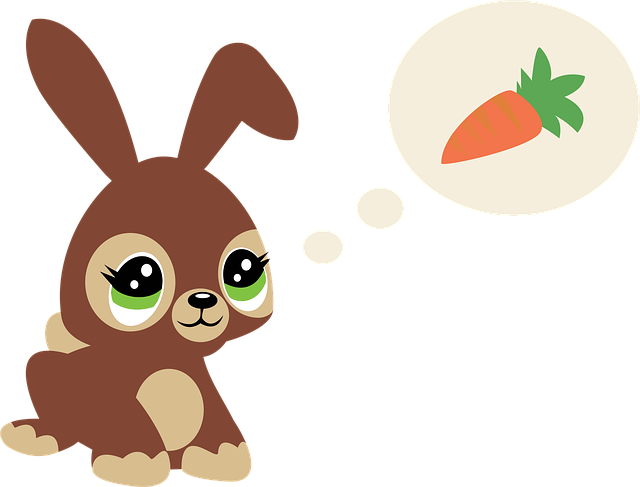
Nach dem sogenannten „Karotten-Prinzip“ wird zum Beispiel einem Esel als Belohnung eine Karotte vor die Nase gehalten. Wenn er diese Karotte haben möchte, muss er loslaufen. Der Esel wird auf diese Weise die gewünschte Wegstrecke zurücklegen und brav seine Lasten bis zum Ziel tragen. Dieses „Karotten-Prinzip“ wird auch in vielen Betrieben angewandt. Mit dem Belohnungs- und Prämiensysteme werden den Mitarbeitern Geld- oder Sachprämien in Aussicht gestellt. Prämien sind stets mit bestimmten Leistungen verknüpft sind. Wer Belohnung will, muss Leistung erbringen.
Die Inszenierung in Squid Games verstärkt die Kritik: Während die Spieler leiden, wird das Geschehen von Kameras überwacht; der Spielleiter sitzt in Sicherheit, hört Sinatra („Fly Me to the Moon“) und beobachtet aus der Distanz — eine Schlüsselszene, die Machtasymmetrie und Entmenschlichung offenlegt. Diese Trennung von Beobachtern und Leidenden ist ein Spiegel kapitalistischer Strukturen: wenige profitieren, viele zahlen den Preis.

Die Serie zeigt die Gleichzeitigkeit extremer Gegensätze — unglaublicher Reichtum neben existenzieller Not. Namen wie Jeff Bezos oder Elon Musk stehen metaphorisch für jene, die im globalen System außerordentlich reich werden, während Millionen Menschen hungern; Oxfam schätzt weiterhin dramatische Zahlen von Hungernden weltweit. Squid Game erinnert dabei an andere kritische Werke wie George Orwells Farm der Tiere: die Ungleichheit wird durch ein eindringliches, zugespitztes Beispiel literarisch verdeutlicht (dazu auch unser Beitrag „Animal farm“ – vom Hund auf’s Schwein gekommen„)..

Die Spiele selbst spiegeln zudem, wie ungleich die Startbedingungen sind. Nicht jeder geht mit demselben physischen, kognitiven oder sozialen Rüstzeug ins Rennen — das zeigt etwa das Murmelspiel oder das Tauziehen, in dem Betrug, List oder körperliche Stärke entscheidend sein können. Im Kapitalismus bestimmt oft schon die Geburt über Chancen und Ressourcen. Wenn einige Teilnehmer geheime Tipps für kommende Spiele erhalten, ist das fairer Wettbewerb? Natürlich nicht. Die Serie demonstriert damit, dass das Leistungsprinzip nur dann „gerecht“ wäre, wenn alle dieselben Voraussetzungen hätten — eine Bedingung, die in der Realität selten erfüllt ist.
Dass nur ein Gewinner das enorme Preisgeld erhalten kann, macht die ganze Konstruktion per se unfair: Ein astronomischer Topf, der nur einem Einzelnen zugutekommt, erzeugt Gier, Konkurrenz und Zerstörung. Die Box mit dem Geld hängt wie eine Drohung über den Köpfen der Spieler und verwandelt solidarische Hoffnung in individuelle Habgier. Besonders tragisch ist die Figur Seong Gi-hun: ein arbeitsloser Chauffeur, in Spielsucht versunken, belastet durch Schulden, Fürsorgepflichten und der Verantwortung für seine Mutter und Tochter. Seine Zwangslage macht ihn zur idealen Zielperson für dieses System; das Preisgeld ist für ihn nicht abstrakt, es ist Überlebensoption. Die Serie zeigt so, wie wirtschaftliche Not Menschen in unmenschliche Situationen treibt.
Die Puppe bleibt nach dem Abzug der Kameras und dem Verlöschen der Scheinwerfer stehen — stumm, kalt und unbeeindruckt vom menschlichen Leid, das sie ausgelöst hat. Sie ist der heimliche Star der Show und deshalb eine kritische Würdigung wert.
Danke an den Kulturbotschafter des UniWehrsEL für seine Interpretationen und wie immer Dank an Pixabay für die Bilder. Das Titelbild stammt von Myriam auf Pixabay

