Der Theaterkritiker I. Burn ist ein stark beschäftigter Mann. UniWehrsEL Leser kennen ihn von seinen Recherchen, zusammen mit dem Kriminalkommissar Ritter bei „Tatort Frankfurt, welche Rolle spielt die Musik?“ . Aber er berichtet auch über Opern, Schauspiele und Konzerte wie etwas das Konzert des Internationalen Jugendmusikorchesters Darmstadt in der Orangerie. Die gläserne Pracht der Orangerie in Darmstadt hat es ihm besonders angetan. Für ihn ist dies „ein funkelnder Tempel, der im Winter wie ein kleines Versailles erstrahlt“. Zudem bildete sie den festlichen Rahmen für die Aufführung von Franz Schuberts Winterreise am 23. Oktober 2025. Wie ein jährliches Ritual, das – ähnlich wie die Oper Hänsel und Gretel, die es ihm ebenfalls angetan hat, immer wieder in der kalten Jahreszeit auf den Spielplänen der großen Häuser erscheint. Diesmal hat die Winterreise ihn in ihren eisigen Bann gezogen. Erstaunlicherweise spielte das Geschwisterpaar auch bei den Überlegungen zu „Thüringer Spezialitäten“ eine Rolle.
Liebe UniWehrsEL Leser,
Im Seminar Anima(l), das sich mit menschlichen Seelenzuständen und deren Symbolik beschäftigt, wird das lateinische Wort anima (Seele, Atem) immer wieder mit tierischen Begleitern verknüpft. In Schuberts „Winterreise“ erscheint die Krähe – ein zentrales Tier im Winter, das über weite Strecken Botschaften übermittelt. Es diente der Obrigkeit zur Kontrolle der Bevölkerung, was den politischen Charakter des Liederzyklus andeutet.

In der Comic‑Verfilmung The Crow (1994) (auch unser Beitrag zum Remake von „The Crow“) wird die Krähe als Bote des Todes dargestellt: nach alten Legenden bringt sie die Seelen Verstorbener ins Reich der Toten, und wenn das Schicksal besonders tragisch ist, kann sie die Toten sogar aus dem Jenseits zurückholen. Diese mythologische Funktion der Krähe spiegelt sich in Schuberts Zyklus wider: die Vögel, die über der verschneiten Landschaft kreisen, tragen die unausgesprochenen Botschaften der Todessehnsucht des Protagonisten und verstärken das Bild einer Seele, die zwischen Leben und Tod hin- und hergerissen ist.
Der Bariton Konstantin Krimmel, unterstützt von dem brillanten Pianisten Ammiel Bushakevitz, verlieh dem Zyklus mit seiner tiefen, resonanten Stimme und einer intensiven Bühnenpräsenz neue Schattierungen. Die 24 Lieder, die Schubert auf Texte von Wilhelm Müller komponierte, erzählen die Geschichte eines jungen Mannes, der aus unerwiderter Liebe verzweifelt durch eine Winterlandschaft irrt. Nach einem positiven Auftakt („Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von Eh‘“) wird ein Bruch zwischen den beiden deutlich. Der junge Mann verlässt das „Liebchen“ bei Nacht und Nebel; je weiter er sich von seiner Geliebten entfernt, desto mehr entfernt er sich auch von seinem eigenen Leben.
Ob er am Ende bewusst den Tod wählt oder gar sucht, bleibt offen. Der innere Schmerz des Protagonisten ist „tödlich verletzend“; in der Natur sieht er nur sein eigenes Leiden und den Tod als Spiegelbild seiner Seele.

Die deutsche Sprache kennt für diese Gefühlslage das Wort „Todessehnsucht“ (im Beitrag besprochen im Kontext von Klaus Mann), das unausgesprochen stets im Zyklus mitschwingt. Der Tod ist ein ständiger Begleiter des jungen Mannes und trifft den unvorbereiteten Hörer mit großer Wucht, wenn er sich vorher nicht mit dem Inhalt des Liederzyklus beschäftigt hat. Kein Wunder, dass Schuberts Freunde von der Winterreise damals schockiert waren.
Heutzutage ist das Publikum möglicherweise weniger empfindsam, weil es durch die Medien an Schreckensnachrichten gewöhnt ist und eine gewisse Resilienz gegenüber täglichen Nachrichten entwickelt hat. Dennoch lässt der Zyklus den Hörer keinesfalls gleichgültig zurück – genau die besten Voraussetzungen für einen besonderen Liedinterpreten wie Konstantin Krimmel.
Krimmel hat mit Ammiel Bushakevitz einen genialen musikalischen Begleiter gefunden. Überraschend für Außenstehende, die nicht in der Klassikszene beheimatet sind, ist die Winterreise ein großer Hit beim heutigen Publikum. Trotz der düsteren Schilderung löst die Musik keine Depressionen aus, sondern führt regelmäßig zu Begeisterungsstürmen – so auch in der Orangerie Darmstadt. Dieses emotionale Miterleben kann eine Reinigung der eigenen Seele bewirken; manche Hörer empfinden die Winterreise sogar als meditatives Erlebnis.
Die von Schubert (dem begnet man unter anderem auch im Romantik Museum in Frankfurt)
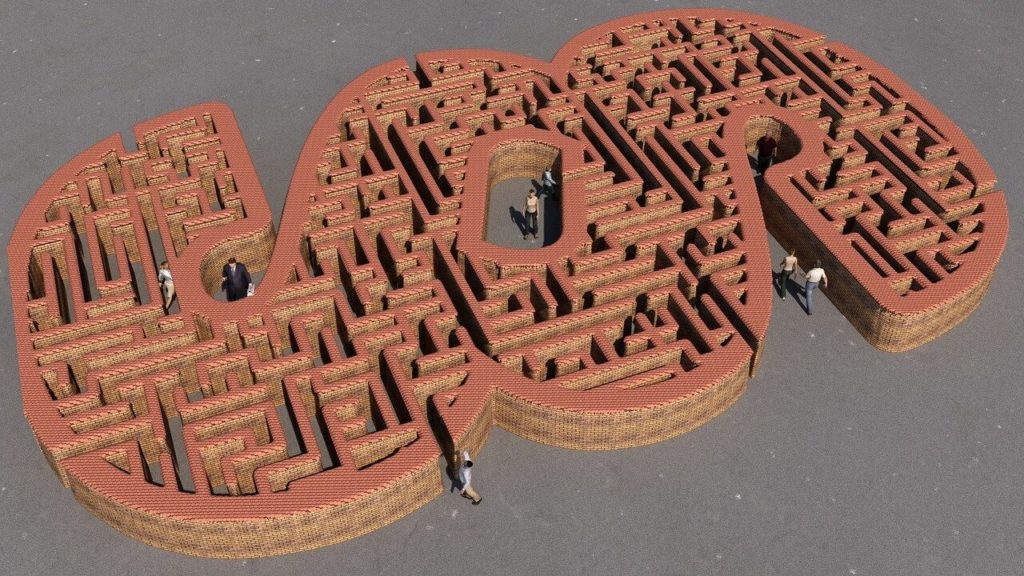
dargestellten seelischen Abgründe werden in sprachlicher Klarheit und mit Einfachheit zum Ausdruck gebracht, sodass die Lieder auf manchen Zuhörern gar eine tröstende Wirkung entfalten. Der Leiermann im letzten Lied ist sicherlich der Tod, der den jungen Mann am Ende holt. Die Winterreise ist ein Eintauchen in eine andere Welt, doch sie kann nicht nur als innere Reise eines jungen Mannes in einer eisigen Umgebung gedeutet werden.
Einige Interpretationen sehen in ihr auch eine politische Botschaft: Die Französische Revolution 1789 weckte Hoffnungen nach einem liberaleren Kaiserreich; Schubert könnte damit ein Aufbegehren gegen das restaurative Metternich‑System ausgedrückt haben. Der „Winter“ symbolisiere das Zurückdrehen der Revolution nach dem Wiener Kongress – ein politisch eisiger Winter, dem der Einzelne zum Opfer fällt.
In einer Stelle heißt es: „Sind wir selber Götter!“ – das könnte bedeuten, dass der junge Mann sich noch einmal zu neuem Lebensmut aufrafft oder sein Schicksal selbst in die Hand nimmt. Wenn kein Gott sich seiner erbarmt und ihn erfrieren lässt, muss er seinem Leben selbst ein Ende setzen und wird zum Gott über sein Schicksal. Der Leiermann ist dabei entweder ein Weggefährte – der Tod als ständiger Begleiter des Lebens – oder ein Teil der Fantasie des jungen Mannes, der im Schnee langsam verrückt wird. Diese Vielschichtigkeit macht die Winterreise so spannend für den Zuhörer.

An dem stimmungsvollen Ort der Orangerie Darmstadt wurde Schuberts Winterreise zu einem rituellen Wintererlebnis, das dank Konstantin Krimmels eindringlicher Baritonstimme, Ammiel Bushakevitz’ virtuoser Begleitung und den symbolischen Verweisen auf die Krähe als Bote des Todes nicht nur die dunklen Abgründe des Zyklus offenbart, sondern das Publikum zugleich reinigt und erhebt. Die Aufführung beweist, dass dieser Klassiker – trotz seiner Schwere – heute noch tief berührt und begeistert.
Mit freundlichen Grüßen
I. Burn
Herzlichen Dank für den interessanten Text und die wunderbaren Bilder auf Pixabay!

