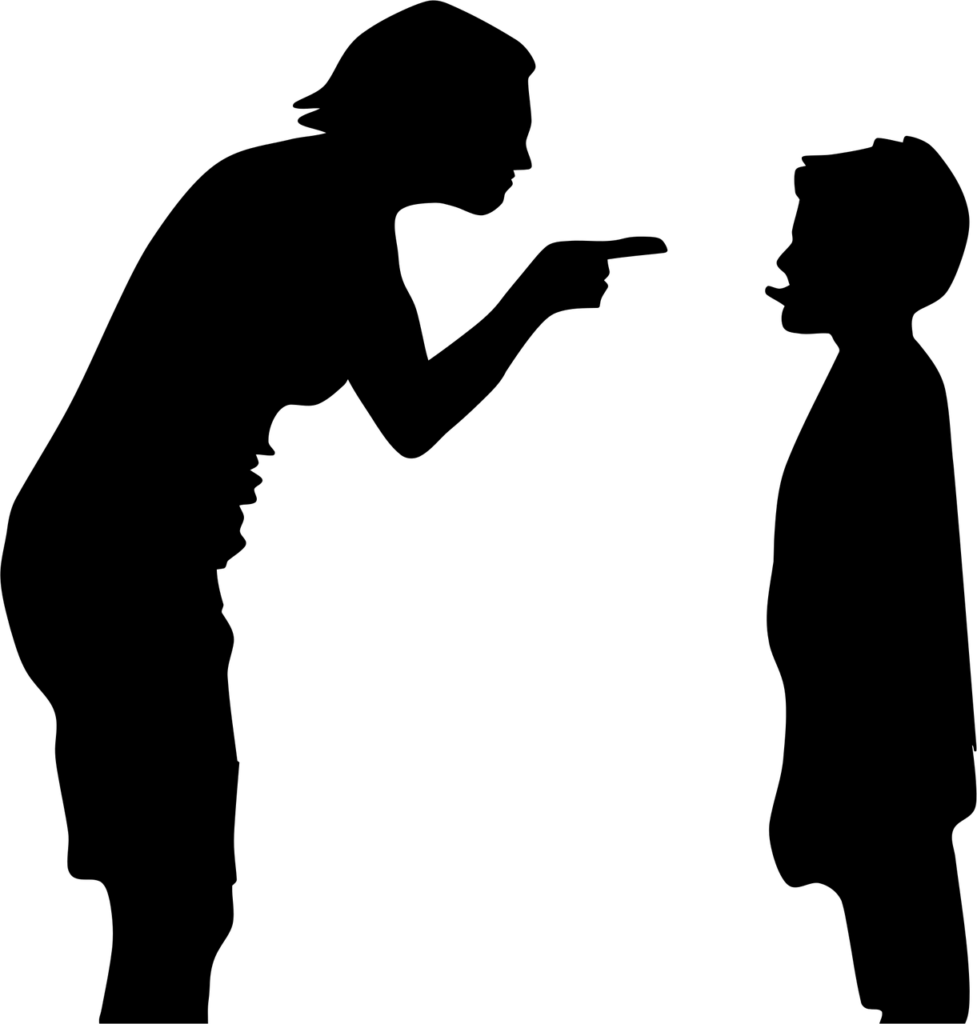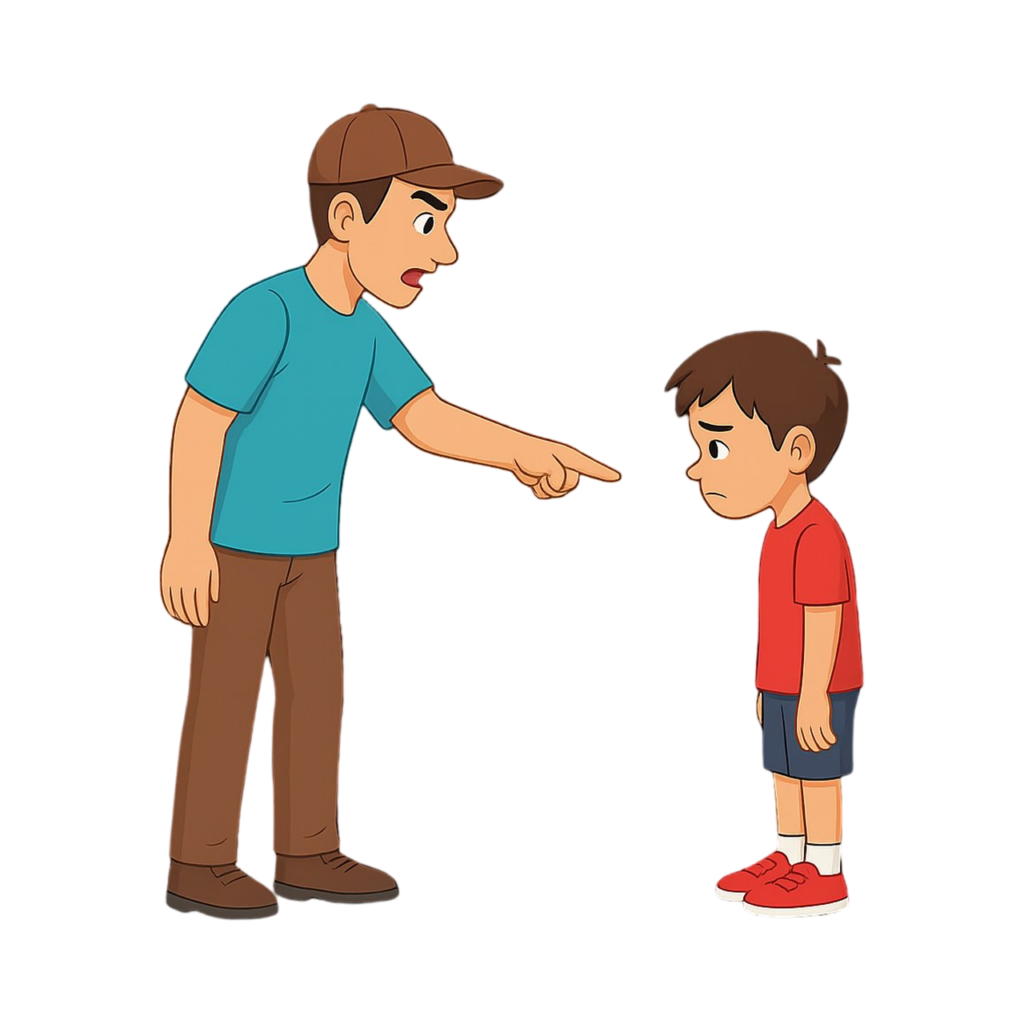In vielen Kindergeschichten gelten Puppen als stille Begleiter, die uns ohne Worte verstehen und unsere innersten Gefühle spiegeln. Sie sind Zeugen unserer Sehnsüchte, Ängste und verborgenen Wünsche – genau wie die Beziehung zwischen Vater und Sohn in Édouard Louis’ Bühnenadaption „Wer hat meinen Vater umgebracht“, die im Schauspiel Frankfurt zu sehen ist. Das Stück greift die autobiografischen Elemente von Louis’ Roman auf und überträgt sie in ein intensives Kammerspiel.
Sehr geehrte Damen und Herren,
Ein junger Mann, der seine eigene Homosexualität entdeckt, steht im Konflikt mit einem Vater, der ihn gleichzeitig liebt, beschämt, ausliefert und misshandelt. Es kommt zum Konflikt zwischen Vater und Sohn als der Vater diesen für zu weichlich und weiblich hält. Auch kann er nicht verstehen, warum der Sohn einen künstlerischen Weg einschlagen will und als erster seiner Familie ein Gymnasium besucht. Für den Vater ist es Zeitverschwendung. An einer Stelle hält der Vater dem Sohn vor, warum er den Film „Titanic“ zu Weihnachten als DVD geschenkt haben will. Das sei doch ein Film für Mädchen. Der Sohn versucht, sich in die Position des Vaters zu versetzen, um ihn zu verstehen – wie ein Kind, das seine Puppe hält und ihr seine tiefsten Gefühle anvertraut.
Dieses Bild ist kein Einzelfall, sondern spiegelt ein tief verwurzeltes männliches Selbstverständnis wider. Von klein auf erhalten Männer Botschaften, dass Stärke, Durchsetzungsvermögen und emotionale Zurückhaltung das Wesen des Mannes ausmachen. In vielen Familien, Schulen und Medien wird das Bild des „starken Vaters“, der die Familie finanziell und moralisch führt, zum Ideal erhoben. Wer von diesem Ideal abweicht – etwa durch Interesse an Kunst, Romantik oder als „weiblich“ empfundenen Themen – wird schnell als schwach oder untypisch abgestempelt.
In diesem Stück ist der Vater jedoch nicht nur ein Vertreter eines veralteten Männlichkeitsideals, sondern auch ein ungelernter Arbeiter, dessen Leben durch einen schweren Arbeitsunfall grundlegend erschüttert wurde. Der Unfall macht ihn körperlich gebrechlich und zwingt ihn, auf die Hilfe anderer angewiesen zu sein. Diese plötzliche Hilflosigkeit trifft auf ein Selbstverständnis, das von harter körperlicher Arbeit und Eigenständigkeit geprägt ist. Das Unvermögen, sich wie früher zu versorgen, löst bei ihm eine tiefe Verunsicherung aus, die er über das Ablehnen des Weiblichen kompensieren will.
Der Vater im Stück lebt genau diese Vorstellung. Sein Unverständnis gegenüber dem künstlerischen Wunsch seines Sohnes ist weniger ein persönlicher Groll als ein Ausdruck der Angst, die eigene Männlichkeit zu verlieren (Image by izafi from Pixabay). Das Ablehnen des Weiblichen dient ihm als Schutzmechanismus: Indem er das Interesse seines Sohnes an einem Film wie Titanic als „Mädchen‑Sache“ abtut, bestätigt er sich selbst und sein Umfeld darin, dass er noch zum traditionellen Männerbild gehört. Gleichzeitig projiziert er seine eigenen, vielleicht nie verwirklichten Träume und die Sorge, von anderen Männern verspottet zu werden, auf den Sohn.
Die Entdeckung seiner eigenen Homosexualität erfolgt zunächst im Verborgenen: beim kindlichen Spiel, beim heimlichen Anschauen von Pornografie in der Jungengruppe und Nachspielen von Szenen. Als sein Vater schließlich davon erfährt, reagiert er mit Scham und Ablehnung, was die innere Zerrissenheit des Sohnes noch verstärkt.

Die Regie von Lisa Nielebock nutzt markante Momente aus dem Roman „Wer hat meinen Vater umgebracht“ von Édouard Louis (er hat auch „Das Ende von Eddy“ geschrieben), um die Zerrissenheit der Figuren zu verdeutlichen. Die wütenden Reden des Vaters im Suff, die brutalen Schläge gegen die Plexiglaswand und das Splittern von Glasflaschen erzeugen ein Bild von Gewalt, das an zerbrochene Puppenteile erinnert. Der Unfall des Vaters in der Fabrik, der ihn arbeitsunfähig macht und auf Zuwendung angewiesen lässt, lässt ihn selbst zur hilflosen „Puppe“ werden, die Pflege benötigt. Die Mutter erscheint zunächst in einem verschwenderisch roten Hosenanzug, fast wie eine übergroße Puppe, die zwischen Glamour und Armut hin‑ und hergerissen ist, bevor sie später in grauen Jogginghosen und einem schlichten Sweatshirt wieder in ihr altes Ich zurückkehrt.
Ein besonders eindringlicher Abschnitt des Stücks zitiert die politische Situation in Frankreich:
„August 2017. Emmanuel Macron nimmt den ärmsten Franzosen fünf Euro pro Monat weg, er behält fünf Euro pro Monat von der Wohnungsbeihilfe ein, die den ärmsten Franzosen hilft, ihre Miete zu zahlen. Am selben Tag kündigt er eine Absenkung der Vermögenssteuer für die Reichsten an. Er findet, die Armen haben zu viel, die Reichen zu wenig. Seine Regierung erläutert, fünf Euro seien doch unerheblich.“
Der Schauspieler Thorsten Flassig wird an dieser Stelle sehr politisch. Fast tritt der Schauspieler in dieser Szene auf wie ein Politiker, der eine kämpferische Rede vor Publikum hält. Diese Passage wird im Stück als Kommentar zur wachsenden Ungleichheit und zur Verantwortung des Staates verwendet. Sie lässt sich unmittelbar auf aktuelle Diskussionen um den deutschen Sozialstaat übertragen: Während in Deutschland die Grundsicherung, das Kindergeld und die Miet‑ und Heizkostenzuschüsse als Pfeiler des sozialen Netzes gelten, wird gleichzeitig über Kürzungen, steigende Mieten und die Belastung von Geringverdienern debattiert. Die Szene wirft die Frage auf, inwieweit staatliche Entscheidungen das familiäre Gefüge zerschneiden oder schützen.
Durch diese Bildsprache entsteht ein Spannungsfeld zwischen Zärtlichkeit und Gewalt, das das Publikum unmittelbar spürt. Die familiäre Dreiecksbeziehung – Vater, Mutter und Sohn – verdeutlicht, wie schwer es für die Eltern ist, die „weibliche“ Seite des Sohnes zu akzeptieren. Der Sohn entdeckt seine Homosexualität und muss sich mit der Ablehnung und Scham des Vaters auseinandersetzen, während er gleichzeitig nach Anerkennung und Sichtbarkeit dürstet. Die Grenze zwischen Literatur und autobiografischen Elementen verwischt: das Stück wirkt authentisch, bleibt aber zugleich stark fiktional. Der Autor hat das Gefühl, dass seine Geschichten in der Gesellschaft kaum Gehör finden, und sieht deshalb die Literatur als Mittel, um seine Stimme hörbar zu machen – ganz wie eine Puppe, die zugleich Spielzeug und Spiegel des eigenen Selbst ist.
Die Grenze zwischen Literatur und autobiografischen Elementen verwischt: das Stück wirkt authentisch, bleibt aber zugleich stark fiktional. Der Autor hat das Gefühl, dass seine Geschichten in der Gesellschaft kaum Gehör finden, und sieht deshalb die Literatur als Mittel, um seine Stimme hörbar zu machen – ganz wie eine Puppe, die zugleich Spielzeug und Spiegel des eigenen Selbst ist. Die Titelfigur und Erzähler ist eine Mischung aus der realen Person des Autors und einer erdachten Figur. Im deutschen Buchmarkt gibt es auch autofiktionale Romane wie z.B. „Das bin doch ich“ von Thomas Glavinic oder „Hoppe“ von der

Autorin Felicitas Hoppe (sie findet auch Erwähnung in unserem Beitrag Sehnsuchtsorte: Taiga, Wald und der Song „Mein Freund, der Baum ist tot“).
Der Aufführung im Schauspiel Frankfurt gelingt es, diese Ambivalenz auf die Bühne zu bringen. Die intensiven Schläge, das Splittern der Glasflaschen und die körperliche Hilflosigkeit des Vaters erzeugen ein greifbares Bild von Selbsthass, Anklage und dem tiefen Wunsch nach Anerkennung. Die Darsteller, allen voran Torsten Flassig, vermitteln die rohe Emotionalität, die Louis in seinem Roman beschreibt.
Abschließend lässt sich sagen, dass das Stück nicht nur ein weiteres Vater‑Sohn-Porträt ist, sondern ein Bekenntnis zur Sichtbarkeit marginalisierter Stimmen. Wie eine Puppe, die uns leise, aber unverkennbar ihre Geschichte erzählt, fordert „Wer hat meinen Vater umgebracht“ das Publikum auf, die zerbrechlichen, oft übersehenen Beziehungen in unserer Gesellschaft zu hören und zu benennen – und gleichzeitig die politischen Entscheidungen zu reflektieren, die das Leben von Familien im Sozialstaat prägen.
Mit freundlichen Grüßen
Izzi Nalan