„So langsam, so leise“ ist ein eindringliches Stück am Schauspiel Frankfurt. Karen, die eigentlich nur ihren an Demenz leidenden Vater besuchen will zwingt der Dauerregen zu bleiben. Der Kulturbotschafter des UniWehrsEL hat das neue Stück von Björn SC Deigner am 01.11.25 gesehen und möchte seine Eindrücke schildern. Der Regen, der seit Tagen unaufhörlich fällt, ist nicht nur ein Wetterphänomen, sondern ein Brandbeschleuniger für die gesamte Atmosphäre des Stücks. Er dringt durch jede Ritze des alten Familienhauses, löst die Tapete, tränkt die Wände und lässt das Haus – das einst stolz über dem Tal thronte – in einem Zustand des Verfalls zurück. Dieser dauerhafte Regen wird zum Symbol für den Weltschmerz, den die Titelheldin Karen (gespielt von Amelle Schwerk) empfindet, während sie in das Haus ihrer Kindheit zurückkehrt.
Liebe Leser des UniWehrsEL,
es ist eine Welt, die sich buchstäblich vor den eigenen Augen aufzulösen scheint: Extremwetterereignisse bedrohen sicher geglaubte Rückzugsorte, die schwindenden Erinnerungen lassen die Identität bröckeln und reißen zugleich alte Wunden von neuem auf. Die Vater-Tochter Beziehung steht im Zentrum des Dramas. Karen, eine Nachwuchswissenschaftlerin der theoretischen Physik, sieht sich mit der Demenz ihres Vaters (gespielt von Matthias Redlhammer) konfrontiert, die sich in vergessenen Töpfen auf dem Herd und plötzlich aggressivem Verhalten manifestiert.

Demenz wird in der Kultur, Literatur und im allgemeinen Diskurs häufig als eine mächtige Metapher für Verfall, Verlust und Untergang verwendet. Diese Metapher kann sich sowohl auf den persönlichen Untergang eines Individuums als auch auf den Untergang gesellschaftlicher oder kultureller Werte beziehen.

„Verlust„, so beschreibt es Andreas Reckwitz in seinem Buch, das uns Thomas Kraft in unserem Seminar vorstellte, hängt zusammen mit dem negativen Erleben des Einzelnen oder auch der gesamten Gesellschaft durch das Verschwinden von Dingen, Objekten, sozialen Praktiken. Voraussetzung, etwas als Verlust zu erleben, sei eine emotionale Bindung zum Verlorenen, zudem sei der Verlust irreversibel und bleibe unverfügbar. Diese Verlusterfahrung sei Identitätsbildend und bewirke, sich nicht mehr als der zu empfinden, der man einmal war. Der Mensch könnte dabei sein Gleichgewicht verlieren.
Das Haus wird zum Spiegel ihrer eigenen Vergänglichkeit: die feuchte Luft, das stetige Tropfen und das allgegenwärtige Rauschen des Regens verdeutlichen, wie schnell Erinnerungen schwinden und Identität ins Wanken gerät. Der Regen (gespielt von Nina Wolf) spricht dabei fast wie ein eigenständiger Charakter: er ist gewitzt böse und zugleich banal, folgt seiner eigenen Logik und ignoriert menschliche Regeln.

Das erinnert unmittelbar an Karen Duves „Regenroman“. Auch da zeigt sich Regen von seiner bösen Seite, denn auch dort schüttet des Ohne Ende. In der Welt des Paares Leon und Martina herrscht Dauerregen. Im neu gekauften Haus rinnt braune Brühe aus der Dusche und schleimige Schneckenhorden fressen den Garten leer. Eine Geschichte des Verfalls, aus der es kein Entrinnen gibt.
In „So langsam, so leise“ wird der Abschied thematisiert, von einer liebgewonnen alten Welt, die sich sinnbildlich auflöst. Rückzugsorte wie das Haus des Vaters werden durch Extremwetterereignisse zu tödlichen Fallen, schwindende Erinnerungen lassen an der eigenen Identität zweifeln und alte Wunden werden aufgerissen.
In einem Gespräch zwischen Vater und Tochter verflechten sich Erinnerungen an die Kindheit, an die Anfänge der europäischen Zivilisation und an die Gegenwart. Karen ringt um ihren Platz in der Gesellschaft: Ausbleibende Projektförderung und befristete Stellen im Forschungsbereich lassen sie vor dem beruflichen Nichts stehen. Das Versprechen einer besseren Zukunft für die Kinder, an das ihr Vater noch glaubte, zerbricht, weil sich die Lebensumstände und Regeln der akademischen Welt verändert haben. Karen spürt, sie wird keine Karriere in der Wissenschaft machen, wie es dem Vater noch möglich war. Tragischerweise wird er seine Forschung zur frühen Hochkultur der Donauzivilisation nicht abschließen können, aufgrund seiner Krankheit.
Der Forschung des Vaters liegt eine tiefere Metapher zugrunde: Seine Studien zur frühen Hochkultur der Donauzivilisation stehen sinnbildlich für den Verfall des alten Europas, seiner industriellen Welt und Wirtschaft. Wie das verfallende Haus, das dem Dauerregen nicht standhält, scheitert auch das traditionelle, auf Schwerindustrie und starre Bürokratie gegründete Wirtschaftssystem daran, sich an die neue, digitale und nachhaltige Zeit anzupassen. Der Vater versucht, ein vergessenes Kapitel der Geschichte zu retten, doch seine Demenz und die unaufhaltsame Feuchtigkeit des Regens zeigen, dass das alte Europa – genau wie das Haus – im Begriff ist, zu zerfallen, weil es den Wandel nicht mehr aufnehmen kann.

Der Regen ist im Stück nicht nur ein Stilmittel, sondern eine eigene Figur. Er spricht über Anfänge und Enden, über Pflanzen, Tiere und Menschen, die vom Regen durchnässt oder in seiner Sprache „reingewaschen“ werden. Mal gewitzt, mal bösartig, er folgt seiner eigenen Logik, einem Rhythmus, der außerhalb der menschlichen Zeit liegt. Die Zeitspannen, die er kennt, reichen von Jahrmillionen, doch selbst er scheint sich zu verändern – ein möglicher „Fehler im System“.
Ein besonders eindringlicher Moment ist die Begegnung mit einem Hund (dargestellt vom Tänzer Max Levy und gesprochen aus dem Off von Melanie Straub), der im Regen erscheint. In Anlehnung an das Seminar Animal wird der Hund zum Spiegel der Seele. Das wird deutlich
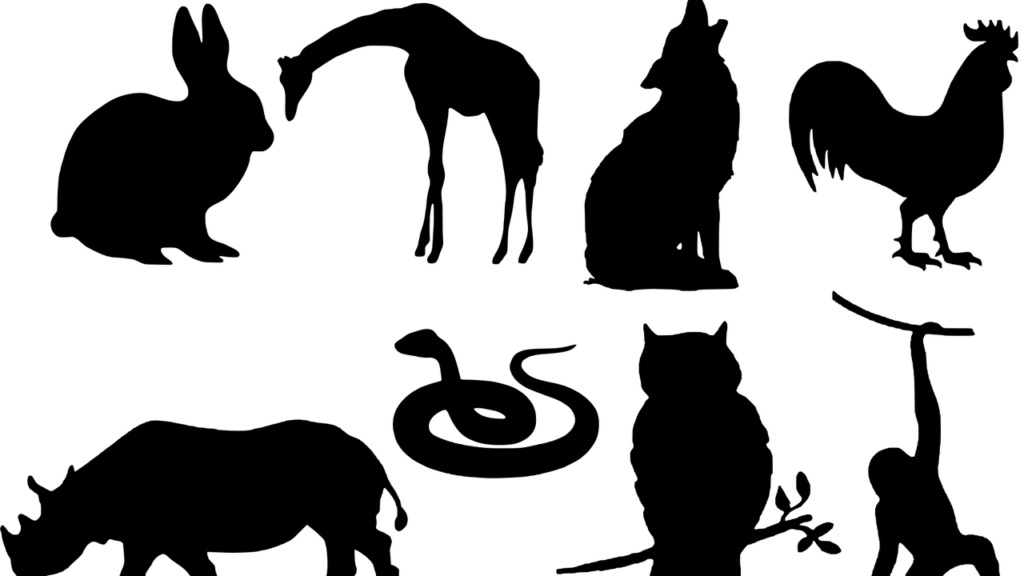
in Beiträgen wie „Orpheus Hund“ von Maxi Obexer.
Karen fragt den Hund, wem er gehöre, und erhält die Antwort „Ich gehöre niemandem.“ Diese Aussage erinnert an Donna Haraways Manifest des Gefährten, das den Hund als treuen, aber eigenständigen Begleiter des Menschen beschreibt. Der Hund, von einem Tänzer verkörpert, verdeutlicht die tiefe, fast symbiotische Verbindung zwischen Mensch und Tier – ein Plädoyer dafür, diese Beziehung bewusst zu würdigen.
Die Regie von Luise Vogt verdichtet die Welt des Stücks durch Musik, alte Videotechnik und Projektionen, die Bilder einer glücklicheren Vergangenheit zeigen. Der Arbeitsraum des Vaters, gleichzeitig Küche und Lebensraum für Vater und Tochter, wird zum Zentrum des Geschehens. Videoprojektoren werfen Erinnerungen an vergangene Zeiten an die Wände, während der Regen von außen das Geschehen beeinflusst.

„So langsam, so leise“ ist ein kraftvolles Porträt von Verfall, Weltschmerz und dem unaufhörlichen Regen, das die Zerbrechlichkeit familiärer Bindungen, die Unsicherheit einer neuen Generation und die tiefe Verbindung zwischen Mensch und Tier eindringlich beleuchtet.
Mit freundlichen Grüßen, Ihr Kulturbotschafter des UniWehrsEL
Danke für diesen eindringlichen Beitrag und die Bilder auf Pixabay und für das Titelbild „Lonely“ von Pheladi Shai auf Pixabay!

