Jean-Philippe Rameau taucht im UniWehrsEL immer einmal wieder einmal auf. So im Kontext des Donner in Mythos, Theater und Wissensgeschichte. Aufgegriffen wird dort das Handbuch „Sound“ (2018), in dem Nicola Gess (auch unsere Grundlagenliteratur im Sommersemester 25) den Theaterdonner als „Inbegriff des Special Effects“ beschreibt, der Realität und sinnliche Eindrücke vermitteln soll. Als Beispiel nennt sie Rameaus „Zoroastre“, ein Opernspektakel des französischen Barocks mit der ‚fabelhaften‘ Handlung um den Lehrmeister der Magier; übrigens mit zahlreichen sensorischen Reizen im Theater Münster 2024 aufgeführt. Begeistert zeigen sich auch die Zuschauer, die „Platée“ von Jean-Philippe Rameau in Prag erleben dürfen. 1745 in Versaille uraufgeführt, geht es komödiantisch um eine hässliche Nymphe, die sich einbildet, Gott Jupiter liebe sie. Platée ist eine enge Verwandte des bekannten Mythos um Semele (dazu auch Beitrag Händels Semele), eine Figur, die durch Selbsttäuschung und Verzauberung in die Mitte einer herzlosen Verschwörung gerät.
Liebe Blogleser,
Was schenkt man einem Königspaar zur Hochzeit? Blumen? Schmuck? Oder vielleicht eine Oper über eine hässliche Sumpfnymphe, die von einem Gott verspottet wird? Genau das war der Anlass für die Uraufführung von Jean-Philippe Rameaus „Plateé“ im Jahr 1745. Die Oper wurde zur Hochzeit von Louis XV., dem französischen Königssohn, und der spanischen Infantin Maria Theresia geschrieben. Doch wie romantisch ist eine Geschichte, in der die Braut als männliche Witzfigur dargestellt wird? Kein Wunder, dass das junge Paar alles andere als begeistert war. Und wir fragen uns: Ist „Plateé“ eine Umkehrung des klassischen Märchens? Normalerweise findet ein Prinz eine schöne Prinzessin, überwindet Hürden für sie und gewinnt sie für sich. Hier jedoch ist die Titelheldin hässlich, unattraktiv und lebt in einem trostlosen Sumpf. Darf man mit hässlichen Frauen anders umgehen? Eine moralische Frage, die auch heute noch zum Nachdenken anregt.
Die Handlung: Liebe als grausamer Scherz
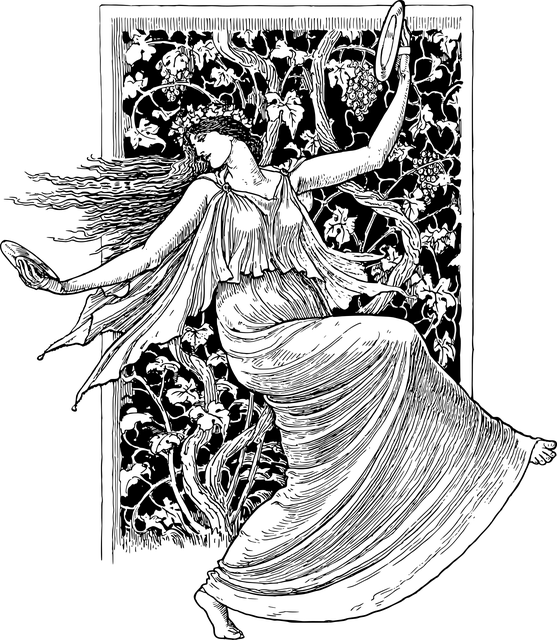
Die Oper erzählt die Geschichte der Sumpfnymphe Plateé, die von Jupiter in ein grausames Spiel verwickelt wird. Um seine Frau Juno von ihrer obsessiven Eifersucht zu heilen, täuscht Jupiter Plateé eine Liebesbeziehung vor. Plateé, geprägt von Eitelkeit und Selbsttäuschung, glaubt an die große Liebe, obwohl sie von stummen Fröschen in einer trostlosen Umgebung bewundert wird. Am Ende bleibt Plateé allein, während Juno und Jupiter ihre Beziehung erneuern. Die Oper ist eine bittere Parodie auf Liebe und Eifersucht, die den Zuschauer mit Plateés Schicksal mitleiden lässt.
Die Inszenierung: Trash-TV trifft Barock
Louisa Muller inszeniert „Plateé“ als Reality-Show im Stil von „Love Island“. Dieses Format, bekannt für seine grellen Farben, künstliche Dramatik und oberflächliche Beziehungen, dient als perfekte Kulisse für die Oper. „Love Island“ ist eine Sendung, in der junge Menschen in einer luxuriösen Villa um Aufmerksamkeit und Liebe kämpfen – oft begleitet von Schönheitsoperationen und inszenierten Konflikten. Die Bühne, gestaltet von Christopher Oram, ist knallbunt, mit Neonröhren und einem Swimming-Pool, dekoriert mit rosafarbenen Flamingos. Jupiter wird als Macho dargestellt – arrogant, selbstverliebt, manipulativ und dominant – und umschwärmt von einem Chor aus „hochgetunten“ Frauen (dazu auch unser Beitrag zu The Substanz und dem Schönheitswahn).
Plateé und die Schönheitserwartungen an Frauen
Plateé ist eine Figur, die von Eitelkeit und Selbsttäuschung geprägt ist. Sie glaubt an ihre eigene Attraktivität, obwohl sie von stummen Fröschen bewundert wird und in einer trostlosen Umgebung lebt. Diese Diskrepanz zwischen ihrer Wahrnehmung und der Realität wird in der Inszenierung durch die Besetzung mit einem männlichen Tenor verstärkt. Die wunderschöne Stimme des Sängers steht im krassen Gegensatz zu Plateés hässlichem Äußeren und wirft die Frage auf: Warum wird Schönheit so oft als oberflächliches Ideal dargestellt? Plateé wird zum Symbol für die gesellschaftlichen Erwartungen an Frauen, die oft unter dem Druck stehen, sich selbst zu optimieren, um den männlichen Blick zu erfüllen.(dazu auch Liebesklischees und male gaze)
Der „Male Gaze“ und seine Auswirkungen

Der Begriff „Male Gaze“ beschreibt die Art und Weise, wie Frauen in Kunst und Medien aus der Perspektive eines männlichen Betrachters dargestellt werden. Frauen werden oft auf ihre äußere Erscheinung reduziert und als Objekte der Begierde inszeniert. In „Plateé“ wird dieser Blick durch die Parodie auf die Schönheitserwartungen verstärkt. Plateé, die hässliche Sumpfnymphe, wird von Jupiter manipuliert und verspottet – ein grausames Spiel, das die Machtverhältnisse zwischen Männern und Frauen offenlegt. Die Inszenierung zeigt, wie der Druck, die perfekte Partnerin zu sein, Frauen dazu bringt, ihren Körper zu optimieren und sich Schönheitsidealen anzupassen, die oft unrealistisch und unerreichbar sind.
Selbstoptimierung und Feminismus
Die moderne Gesellschaft ist geprägt von einem Streben nach Perfektion, das sich besonders in der Selbstoptimierung des Körpers zeigt. Schönheitsoperationen, Diäten und Fitnessprogramme sind Ausdruck eines gesellschaftlichen Drucks, der Frauen dazu zwingt, sich ständig zu verbessern. Doch was bedeutet das für den Feminismus? Ist die Anpassung an Schönheitsideale ein Akt der Selbstbestimmung oder eine Form der Unterwerfung? Plateé, die von einem Mann gespielt wird, stellt diese Fragen auf provokante Weise. Ihre Rolle zeigt, wie Schönheit und Weiblichkeit konstruiert werden und wie diese Konstruktionen Frauen beeinflussen.
Psychologische Einordnung und Gesellschaftskritik
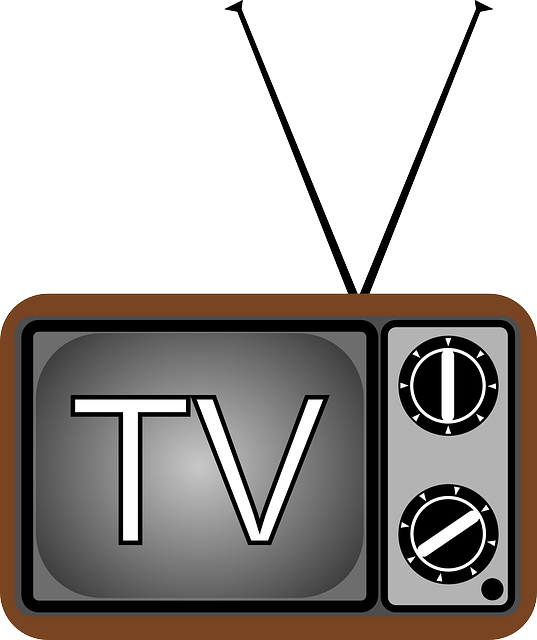
Die Inszenierung wirft einen kritischen Blick auf die britische Gesellschaft und ihre Faszination für überdrehte Reality-TV-Formate. Diese Formate spiegeln eine Sehnsucht nach Aufmerksamkeit und Bestätigung wider, die auch in der barocken Oper präsent ist. Die Parallelen zwischen Barock und Trash-TV zeigen, wie sich gesellschaftliche Themen über Jahrhunderte hinweg wiederholen: Die Suche nach Liebe, die Manipulation durch Macht und die Darstellung von Schönheit als oberflächliches Ideal.
Fazit: Was verrät „Plateé“ über die Sehnsucht nach Liebe und Schönheit?
„Plateé“ ist mehr als eine barocke Komödie – sie ist eine kritische Auseinandersetzung mit den Schönheitsidealen und Geschlechterrollen, welche die heutige Gesellschaft prägen. Die Inszenierung von Louise Muller bringt diese Themen in die Gegenwart und zeigt, wie aktuell sie sind. Plateé, Jupiter und Juno sind Figuren, die von der Sehnsucht nach Liebe und Anerkennung getrieben werden, doch ihre Geschichten offenbaren die Machtstrukturen und Erwartungen, die diese Sehnsucht formen. Die Oper ist noch bis zum 15. Mai bei OperaVision auf YouTube abrufbar und bietet eine einzigartige Gelegenheit, über diese spannenden Fragen nachzudenken.
Mit besten Grüßen vom Team UniWehrsEL
[TRAILER] PLATÉE by Jean-Philippe Rameau
Danke für Image by Sandy Flowers from Pixabay

