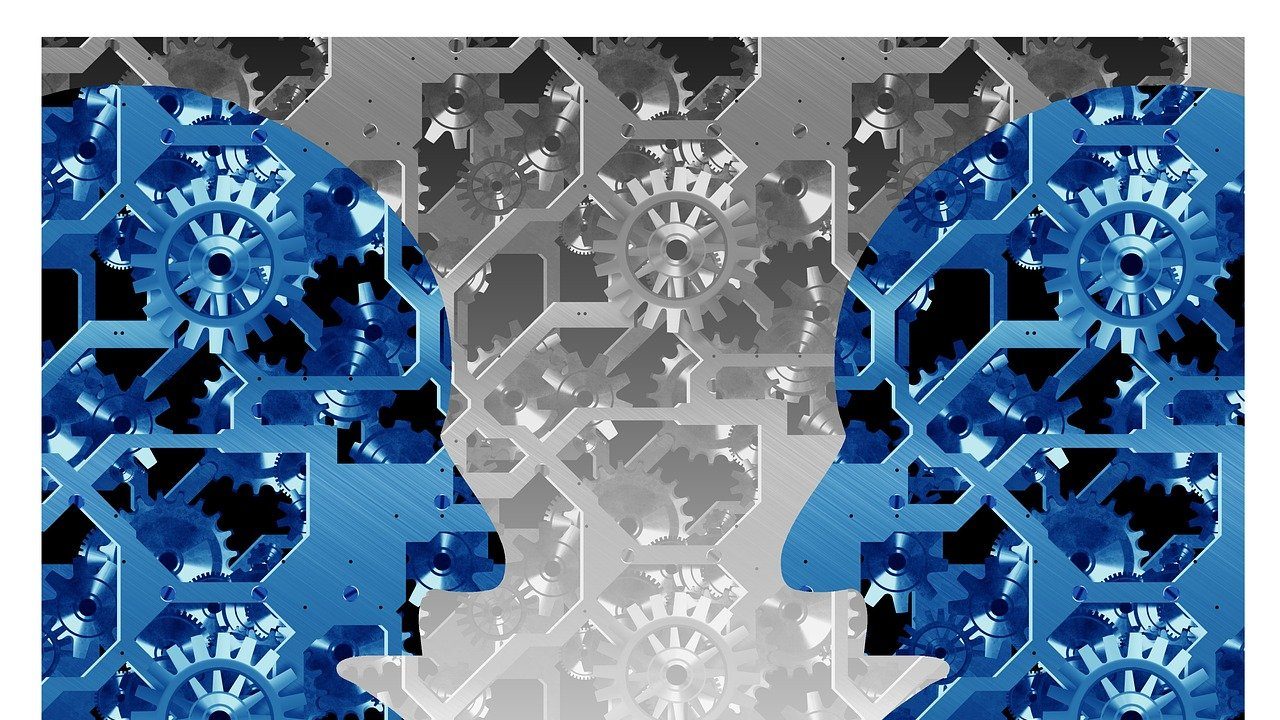Der deutsche Germanist Rasmus Rehn legte 2020 eine spannende Dissertation vor, die er mit Eine Geschichte des Verhältnisses von Literatur und Wahnsinn betitelte und den Untertitel „Experimente jenseits der Sprache“ anfügte. Inhalt der Studie ist Bedeutung und Funktion psychiatrischen Wissens in der Gegenwartsliteratur. Er belegte durch Analysen und historischen Überblick, wie stark die Gegenwartsliteratur von älteren Vorstellungen des Wahnsinns beeinflusst ist. Hoch interessant sind auch Rehns Ausführungen zur Antipsychiatrie-Debatte mit Forschungen zu Schizophrenie und anderen pathologischen Geisteszuständen und den hinterlassenen Spuren in vielen Prosa-Texten moderner Autoren. Dazu ein zusammengefasster Überblick zur Studie, der den Aspekt des „Wahns“ beleuchtet.
Rehn beginnt mit dem österreichischen Schriftsteller Konrad Bayer. Der hielt in seinem Tagebuch 1963 fest, die Kunst des 20. Jahrhunderts habe „fast alles von den Geisteskrankheiten gelernt“. Als Mitglied der „Wiener Dichtergruppe“, (Gegründet 1950er Jahren um Hans Carl Artmann) wollte er die Normen der konservativen bürgerlichen Gesellschaft Österreichs durch experimentelle Lautdichtung und provokative Happenings in Frage stellen. Junge, radikale Intellektuelle inszenierten unter anderem Gedichte, die die Glossolalie (Zungenrede) psychisch Kranker nachahmten. In den 80er Jahren herrschte reges Interesse an pathologischen Geisteszuständen und Kunstwerken schizophrener Patienten. Die österreichische Compagnie de L’Art brut suchte Anschluss an die Bildnerei der Geisteskranken von Hans Prinzhorn aus dem Jahre 1922. Der deutsche Psychiater Prinzhorn veröffentlichte zahlreiche Kunstwerke psychisch kranker Patienten, die Surrealisten wie André Breton zu alternativen Kunstausstellungen in Europa anregten. Aktuell läuft die Ausstellung „Anima–L“ in Heidelberg.
Definition des Wahnsinns und Anwendung auf spezifische Krankheitskonzepte
Wahnsinn ist ein mehrdeutiger Begriff, zu dem es in der Wissenschaft unterschiedliche Definitionen gab. Unter dem „Wahn“ verstand man früher das „Irresein“; heute spricht man von „Psychosen“.
Wahn steht im Gegensatz zur Wahrheit und zur Realität. Schon die Gebrüder Grimm sahen eine Verbindung zum „kühnen flug der dichterischen phantasie“, stellten jedoch fest, dass Wahn im Allgemeinen eine geistige Erkrankung bezeichne, die mit Wahnvorstellungen, großer Erregung, eben aber auch mit Außergewöhnlichem verbunden ist. In einigen Epochen und Kulturen hat der Wahn eine mythisch-religiöse Konnotation. Schon in der Antike sah man eine Verbindung zu ‚göttlicher Inspiration‘.
Genau diese benötigen auch Dichter und Poeten zum Schreiben. Problematisch kann es werden, wenn neuere Krankheitskonzepte der modernen Psychiatrie unkritisch mit alten historischen Vorstellungen verbunden werden; hat der „Wahn“ doch, so der Autor Rasmus Rehn, weit mehr als nur eine psychiatrisch-medizinische Kategorie, sondern auch eine kulturgeschichtliche Bedeutung.
„Wahnsinn“ kann auf spezifische Krankheitskonzepte wie beispielsweise die Manie, Melancholie und Schizophrenie angewendet werden und Aufschluss über das Zusammenspiel von Kunst und psychischer Devianz geben. Rehn wendet in seinem Dissertationsprojekt „Wahnsinn“ auf alle Arten des permanenten oder zeitlich begrenzten geistigen Selbstverlusts an, die eine Devianz von der Norm darstellen. Diese zeigen sich in Gemütsveränderungen und Verhaltensweisen, denen mit Logik und Empirie nicht beizukommen ist. In seiner Untersuchung widmet sich Rehn nicht nur der Antike, sondern sucht auch die Faszination für Geisteskrankheiten und der Adaption des medizinischen Wissens durch Schriftsteller im 20. Jahrhundert zu klären.
Die Faszination der Schriftsteller an der Welt des Wahns
Wahnsinnige wirken auf die Umwelt oft rätselhaft, so als hätten sie geheimes Wissen in sich. Für sie scheinen die gesellschaftlich festgelegten Regeln nicht zu gelten. Sie wurden deshalb früher als authentischer künstlerischer Ausdruck der eigenen kreativen Schöpfungskraft angesehen. In der Tat ignorieren einige Schizophrene bei ihren schriftlichen Äußerungen die Regeln der Rechtschreibung und Interpunktion. Oft besteht zwischen den Texten, die manchmal collagenartig mit Bildern versehen werden, kein erkennbarer semantischer Zusammenhang. Allerdings sei es, so Rehn, aus psychiatrischer Sicht falsch, von einer gemeinsamen Sprache der Wahnsinnigen auszugehen. Die Schriftproben inspirierten viele Autoren dazu, sich in ihren Romanen selbst über Sprach- und Gattungskonventionen hinwegzusetzen. Sie erweckten damit mitunter den Eindruck, ein psychisch Kranker sei der Schöpfer ihrer Werke.
Beispiele der Darstellungen psychisch Kranker finden sich laut Rehn in den Wahnsinnsanfällen des Herakles oder der Kassandra. Schon in einigen Dramen Shakespeares wie in der Tragödie von König Lear (dazu auch Tom Lanoye „Wenn die alte Königin geht„) lassen sich fortschreitende Demenz oder auch akute Manie charakterisieren, die sich an seinem fehlerhaften Urteilsvermögen festmacht. Auch in Goethes „Wilhelm Meisters Lehrjahre“ lasse sich ein Bruch der Normen ausmachen.
In romantischen Werken finden sich, so Rehn, „mystische Erfahrung der Einheit des Subjekts mit der Natur“, der mit einem „verborgenen inneren Zusammenhang der Dinge“ gedeutet werden kann. Als Beispiel nennt Rehn den wahnsinnigen Einsiedler Serapion in einer Erzählung von E.T.A. Hoffmann.
Schon Friedrich Nietzsche (1844-1900) formuliert Kulturkritik, der Wahnsinn mit dem antiken dionysischen Rausch gleichsetzt. Im Expressionismus (Hochphase 1905-1925) geraten die Wahnsinnigen, zur Gegenfigur des bürgerlichen Spießertums. Georg Heym (1887-1912) beschreibt in seiner Novelle „Der Irre“ irritierende Transzendenz-Erfahrungen. Dazu ein Auszug:
„Aber da war etwas Schwarzes, etwas Feindliches, das störte ihn, das wollte ihn nicht hinunterlassen. Aber er wird das schon kriegen, er ist ja so stark. „Und er holt aus und springt von der Balustrade mitten in die japanischen Gläser, in die chinesischen Lackmalereien, in die Kristalle von Tiffany. Da ist das Schwarze, da ist das, – und er reißt ein Ladenmädchen zu sich herauf, legt ihr die Hände um die Kehle und drückt zu. … Er kniet auf seinem Opfer und drückt es langsam zu Tode. Um ihn herum ist das große goldene Meer, das seine Wogen zu beiden Seiten wie gewaltige schimmernde Dächer türmt. Er reitet auf einem schwarzen Fisch, er umarmt seinen Kopf mit den Armen. Ist der aber dick, denkt er. Tief unter ihm sieht er in der grünen Tiefe, verloren in ein paar zitternden Sonnenstrahlen, grüne Schlösser, grüne Gärten in einer ewigen Tiefe. Wie weit mögen die sein. Wenn er doch einmal da hinunterkönnte, dort unten. Die Schlösser rücken immer tiefer, die Gärten scheinen immer tiefer zu sinken. Er weint, er wird ja niemals dahinkommen. Er ist nur ein armes Aas. Und der Fisch unter ihm wird auch frech, der zappelt noch, dem Biest wird er es schon besorgen, und er drückt ihm den Hals ab. ….“
Einflüsse der Antipsychiatrie-Debatte
Rehn beschreibt die besondere Stellung Deutschlands in Bezug auf Psychiatrie und Literatur in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Hier wurde das Interesse an krankhaften Geisteszuständen wie der Schizophrenie durch die Antipsychiatrie-Debatte der 60er und 70er Jahre befördert. Hier hätten Namen wie Ronald D. Laing oder David Cooper in vielen Werken dieser Zeit ihre Spuren hinterlassen. Autoren, die sich für die Antipsychiatrie-Debatte inspirieren ließen seien Rainald Goetz „Irre“ (1983), Thomas Hettches „Ludwig muß sterben“ (1989) ), Paulus Hochgatterer „Über die Chirurgie“ (1993) oder Thomas Mellers „Die Welt im Rücken“ (2016).
Danke für das Bild von Gerd Altmann auf Pixabay