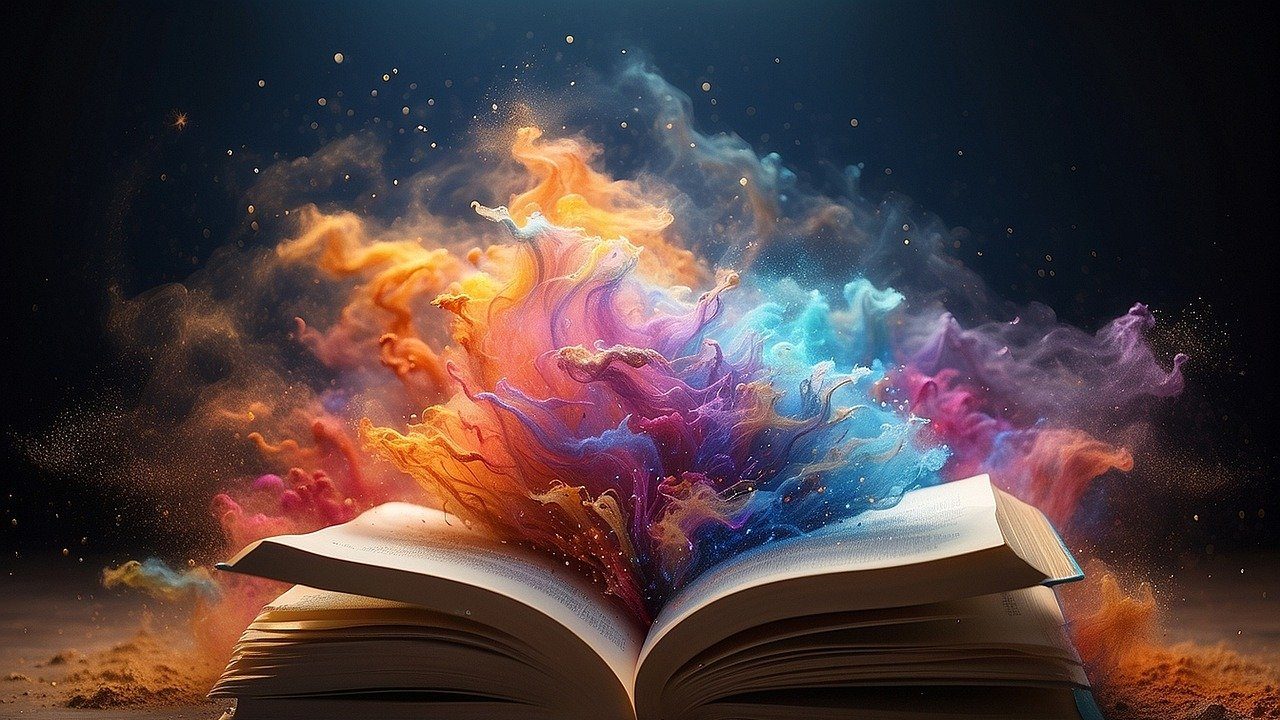Wie erlange ich eigentlich lesendes Bewusstsein, fragt der Literaturwissenschaftler Horst-Jürgen Gerigk, in den Untersuchungen zur philosophischen Grundlage der Literaturwissenschaft. Dabei stellt sich die Frage: „Literaturwissenschaft – was ist das?“ und zieht ihre Antwort aus dem Begriff der „poetologischen Differenz“, der es gestattet ist, den literarischen Text sowohl innerfiktional („psychologisch“) als auch außerfiktional („poeto-logisch“) wahrzunehmen und zu analysieren. Das führt hin zu unserem Seminar Staunen. Wahn, Wunder, Wow-Effekt und zur Semesterlektüre Staunen. Eine Poetik (Kleine Schriften zur literarischen Ästhetik und Hermeneutik) von Nicola Gess.
Beginnen wir mit literaturwissenschaftlichen Ausgangsfragen, im Kontext des kommenden Seminars: Warum staunen wir über so manchen Text? Wie gelingt es Spannung zu erzeugen und im Lesenden die Erwartung zu wecken, wissen zu wollen was, warum und wie etwas geschieht und vor allem, wie es ausgehen wird?
Wer liest hat ein Ziel, er will wissen, welche Erklärung ein geschildertes Geschehen hat. Je nach Typus des literarischen Textes wird dieses Ziel erreicht, in der Schwebe gehalten oder unmöglich gemacht. Um dieses literarische Prinzip zu verstehen, schauen wir uns einmal einige Beispiele an.
Beginnen wir einmal bei Edgar Allan Poes Erzählung „Die Morde in der Rue Morgue“. Mit scharfer Kombinationsgabe klärt hier Auguste Dupin einen rätselhaften Doppelmord, in der den Titel gebenden Straße, auf. Die 1841 veröffentlichte Kurzgeschichte ist Poes erste Detektivgeschichte und steht damit am Beginn der modernen Kriminalliteratur. Mit der Entlarvung des Täters, einem Affen, bekommt das vorher so rätselhaft erscheinende seinen festen Sinn.
Es geht um ein Prinzip des Erzählens, das auch andere Kriminalromane beherrscht. Beispiele dazu liefern Arthur Conan Doyle, Edgar Wallace, Agatha Christie oder Mickey Spillane.
Das Ziel unseres Verstehen-Wollens und die Kunst, den Leser in der Schwebe zu halten, gelingt auch in Dostojewskijs Erzählung „Die Wirtin“. Geschildert wird die hoffnungslose Verliebtheit eines einzelgängerischen Träumers und Büchernarren zu seiner angebeteten neuen Wirtin, die aber ihrem Lebensgefährten verfallen bleibt. Leider wird der fieberkranke Ordynow (und mit ihm der Leser) niemals erfahren, in welcher Beziehung Murin zu Katerina gestanden hat: ob Ehemann, Geliebter oder brutaler Entführer – das bleibt für immer offen.
Auch in der Erzählung „Bis zum Äußersten“ (The Turn of the Screw) von Henry James, in der es um die Beobachtungen der Gouvernante bezüglich der ihrer Obhut anvertrauten beiden Kinder, Flora und Miles, geht, verweigert der Autor die Auflösung. Das verführt zu Spekulationen und Mutmaßungen.
Selbst diese werden dem Leser verweigert, wenn es um das Verstehen in Anton Tschechows Erzählung „Meine Frau“ geht. Da drängt sich nach vielen Irrungen und Wirrungen die Frage auf, was soll das Ganze eigentlich? Ist das vielleicht von Tschechow so gestaltet, weil am Beispiel einer komplizierten ehelichen Beziehung die Kontingenz der bestehenden Welt, die objektiv keinen Sinn ergibt, aufgezeigt werden soll?
Um nun nicht restlos ratlos dazustehen, kurz noch eine Erklärung, welcher buchstäbliche Sinn seiner Natur nach dem Autor eines literarischen Textes, als Möglichkeiten der Verständnislenkung des Lesers, zur Verfügung steht.
Da ist zunächst einmal der „allegorische Sinn“. Mit ihm wird die Metaphorik des buchstäblichen Sinns erfasst. Die Dichtung bedient sich der Metaphern. Schwierig wird es für den Leser, wenn er die „übertragene Bedeutung“ dessen, was wörtlich dasteht, nicht versteht. Dann heißt es wohl, sich mit dem „buchstäblichen“ Sinn zu begnügen. Denn einen hermeneutischen Zwang zur Allegorie gibt es nicht.
Als Beispiel nehmen wir Melvilles „Moby Dick“. Wie könnte man den auch allegorisch lesen? Ein weißer Wal ist eben ein weißer Wal und der fanatische Captain Ahab, der ihn zur Strecke bringen will, hat allen Grund dazu, weil Moby Dick ihm das rechte Bein zertrümmert hat. Das versteht man auch ohne allegorischen Sinn. Da braucht nichts verbildlicht zu werden. Es gibt einen Helden, der exemplarisch dafürsteht, das Böse zu vernichten.
Nun könnte man ja auch sagen, die „Loreley“ steht eben für sich, wozu ihre Metaphorik enthüllen? Allein, der allegorische Sinn ist nicht einfach eine zu verzichtende Zutat. Vielmehr ist er ein unabdingbarer Bestandteil des buchstäblichen Sinns. Zum „Lesenden Bewusstsein“, so der Literaturwissenschaftler Horst-Jürgen Gerigk (1937-2024) gehört, dass „alles Besondere, separiert als Gegenstand von Dichtung, zum Allgemeinen wird, das wiederum als ein solches benannt werden will. Und so lässt sich sagen: Der Blick für den allegorischen Sinn muss trainiert und kultiviert werden, sonst können wir der Natur des literarischen Textes nicht gerecht werden. Die Allegorie lässt, mit Schopenhauer gesprochen, das Einzelne zur „Idee seiner Gattung“ werden.“
Das klingt nun so kompliziert und führt dazu regelrecht aufzuatmen, wenn man erfährt, den „tropologischen Sinn“ zu erläutern, sei weitaus einfacher, denn hier gehe es um die Anwendung des Verstandenen auf mich selbst. Meine persönliche Meinung sei gefragt, und diese würde meistens in einem moralischen Urteil bestehen, zumindest dann, wenn ich mein Urteil veröffentlichen möchte.
In diesem Sinne sei „political correctness“ der strenge Maßstab unserer Öffentlichkeit in der Literaturwissenschaft. Wer sich diesem Maßstab nicht füge, dürfe sich nicht mehr blicken lassen und könne nur noch mit einer Tarnkappe frei herumlaufen.
Und doch schließe der „tropologische Sinn“ eine nicht öffentlichkeitsfähige Stellungnahme gar nicht aus. Wo kämen wir da hin, so fragt Horst-Jürgen Gerigk, wenn „Big Brother“ auch „meine Innerlichkeit bei der Lektüre eines literarischen Textes beobachten würde. Wer wird nicht während der Lektüre von „Verbrechen und Strafe“ mit Raskolnikow gegen den Untersuchungsrichter Partei ergreifen und die Untat Raskolnikows rechtfertigen?“
Schließlich hätte Dostojewskij selbst hat ja seine Konstruktion genau darauf ausgerichtet, den Leser zum Parteigänger seines Mörders zu machen. Einer, der von der großen Tradition und ihrer Beurteilung spricht und immer nur den „tropologischen Sinn“ kenne (ohne ihn so zu nennen), sei Nietzsche. Der frage nur, inwieweit ein literarisches Werk dem frischen Leben der Gegenwart dienlich sei, um seinen Wert zu bestimmen.
Diesem Rat nun folgend, schließe ich als UniWehrsEL mich künftig an und folge weitgehend dem „tropologischen Sinn“, wenn es um den Wert einer Dichtung geht. Denn hier ist dann ja wohl ein Urteil ganz in meinem Sinne und beliebig gestattet.
Wenn Sie nun Lust bekommen haben, Ihre Lieblingsromane einmal vorzustellen und uns gemeinsam raten zu lassen, warum die Auflösung gerade so und nicht anders nach der Intention des Autors hat sein müssen, dann lade ich Sie herzlich zu einem Kommentar ein. Oder noch besser, Sie melden sich ganz schnell bei der U3L an, denn in der kommenden Woche geht es los!