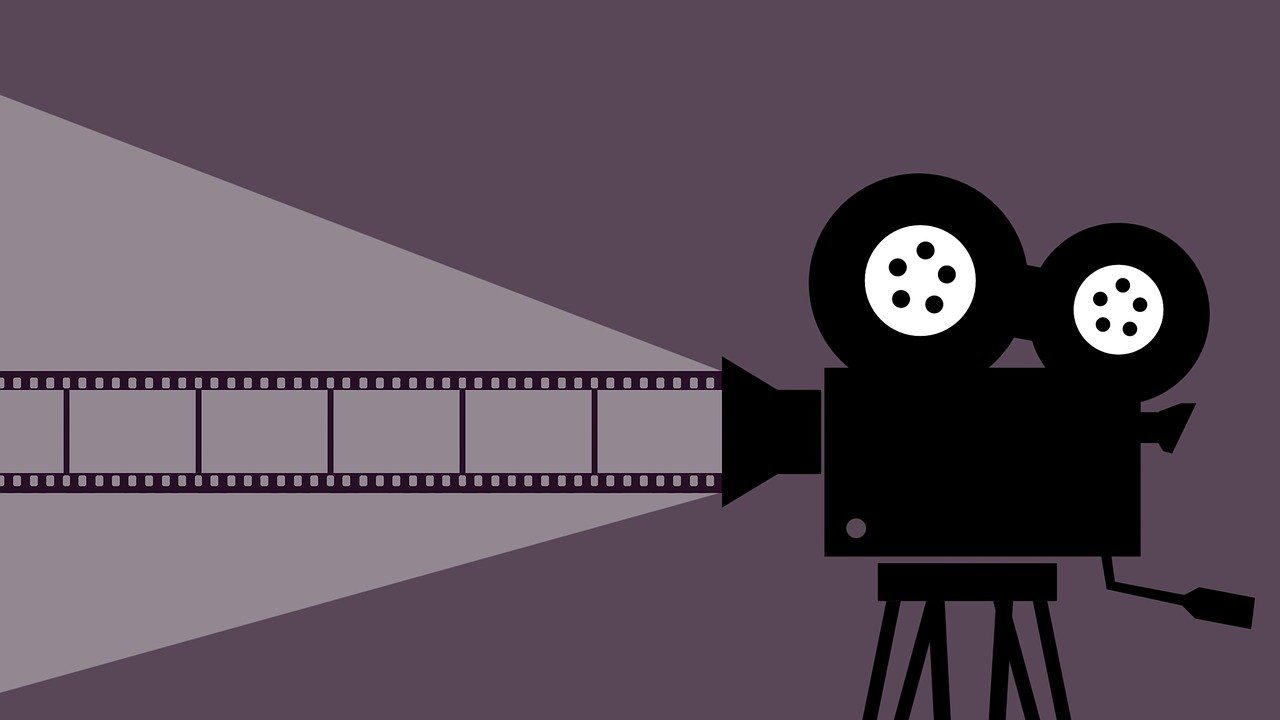Die Zeit nach Weihnachten und Silvester, Freizeit, die wir aktiv oder passiv mit Lesen, Ausstellungsbesuchen, Theater oder auch einmal wieder um ins Kino zu gehen, nutzen könnten. Filme wecken Emotionen wie Staunen, Weinen, Erschrecken, Lachen und Triumphieren, beschreibt der Psychologe Mathias Kohrs, 2018, in Von Irma zu Amalie, zur psychoanalytischen Betrachtung von Traum und Film (S.209) Zweisamkeit, umgebende anheimelnde Dunkelheit, weiche Polster, Flüssigkeiten aus Bechern aufsaugen, vom Dunkeln ins Helle hinaufschauen, klingt verführerisch – frei nach Kohrs – und für mich wäre die Frage und Deutung „warum eigentlich?“ allein schon eine Seminareinheit wert.
Besser als zu theoretisieren ist natürlich das gemeinsame Kinoerlebnis, das Erleben des Rückzugs aus einer Welt, die ja bekanntlich durch „Triebverzicht“ (Sigmund Freud lässt grüßen!) gekennzeichnet ist. Die Folgen dieses Verzichtes auf Dinge, die das „Es“ nachdrücklich verlangt und das „Über-Ich“ nicht akzeptiert, sind uns allen mehr oder weniger bekannt. Psychologisch betrachtet resultieren daraus neurotische Formenbildungen, psychosomatische Störungen, Fehlleistungen im Alltagsleben. Diesen Mangel zu konstatieren genügt nicht, und so taucht die Frage nach Sublimierung auf. Es handelt sich um den Abwehrmechanismus, der es ermöglicht, ‚primitive‘, sozial nicht akzeptierte Arten der Befriedigung von Bedürfnissen in sozial akzeptable umzulenken.
Diese Neutralisierung der Es-Impulse verlangt nach Zielen, denen man sich stattdessen, vom Ich-Impuls legitimiert, uneingeschränkt lustvoll hingeben kann. Da wäre dann, statt des hingebungsvollen Spielens mit Matsch und ähnlichem in der Kindheit, das kreative kunstvolle Gestalten des Erwachsenen zu erwähnen (zum Beispiel die Lust am Kneten und Formen von Ton, um entsprechendes Gestalten zu implementieren). Oder auch, als Folge des auseinander Nehmens des Spielzeugs in der kindlichen Erforschungsphase, die der konstruktiven Ingenieurstätigkeit des reifenden Menschen im beruflichen Dasein weicht.
Diese alltäglichen Abwehrmechanismen gelten nach Freud als unbewusst, dienen der Erhaltung des psychischen Gleichgewichts und helfen – gänzlich automatisiert im Erwachsenenleben – zur Abwehr gegen Schuld und Scham (etwas gesellschaftlich nicht Legitimiertes, wie als Erwachsener im Matsch toben oder absichtlich Spielzeug in Einzelteile zerlegen), zu tun.
Das lässt sich ohne weiteres auf andere Bereiche übertragen, die wir gerne wollen, leider aber uns untersagen müssen. Oder psychoanalytisch ausgedrückt: Wenn wir jetzt wissen, es gibt ein existenzielles Drängen des Körpers, welches dem triebhaften Unbewussten und seiner frühen infantilen Ausrichtungen entstammt, dann wäre es wohl von Interesse zu erfahren, wohin und wozu uns dieses „unbewusste innere Fremde“ drängt.
Die psychoanalytische Wissenschaft ist sich da mehr oder weniger seit Freud relativ einig, diese Kraft wirkt letztlich ganz entscheidend in unseren Träumen nach. Wir träumen demnach zuweilen von dem, was wir eigentlich nicht dürften. Dies hat etwas mit wünschen und inneren Trieben und daraus resultierenden Schuldgefühlen zu tun. Denn die Gesellschaft bestimmt die Werte und Normen, die für uns erlaubt sind. Um ein Mitglied der Gesellschaft zu bleiben, hält man sich an deren Regeln.
Soweit, so gut, nun aber zurück zum eingangs erwähnten, lustvoll erfahrenen, Kinoerlebnis. Die These von Mathias Kohrs ist: Filme haben eine ähnliche unbewusst ablaufende Funktion wie Träume. Sein Wissen über den Zusammenhang zwischen den unbewussten Botschaften, die ein Film vermittelt und deren Entschlüsselung, lässt sich auch – über grundlegende Kenntnisse der Psychoanalytischen Lehre hinaus – ganz gut zu eigenen Erkenntnissen darüber nutzen, was uns bestimmte Filme (so wie es auch Träume tun) über uns verraten.
Beginnen wir also, Kohrs‘ Chronologie folgend, mit prototypischen Filmcharakteren, die etwas über tiefsitzende Wünsche oder Verhaltensweisen verraten. Ein Beispiel davon, wie man gesellschaftlich zwar angesehen, menschlich aber zum Außenseiter wird, weil man sich kompromisslos als ‚Ekel‘ profiliert, zeigt der Hauptdarsteller, von Jack Nicholson dargestellt, in „Besser geht’s nicht“ (James L. Brook 1997). Hochbegabt, neurotisch, dazu als Schriftsteller erfolgreich ist dieser Melvin, mit dem wir den Zwangscharakter vor Augen haben. Sein Verhalten erzeugt beim Zuschauer Abscheu, Fremdscham, Mitgefühl – vielleicht aber auch die geheime Lust, es ihm zuweilen gleich zu tun.
Der Borderline-Pathologie, „zwischen Trieb und Trauma“ zuordnen, lässt sich das Verhalten der Alex, dargestellt von Glen Clos in eine „Verhängnisvolle Affäre“ (1987, Regie Adrian Lyn). Während Dan, dargestellt von Michael Douglas, nur ein ‚Wochendabenteuer‘ anstrebt, bewirkt die Affäre bei Alex einen vollkommenen Besitzanspruch und seine Verweigerung ein völliges Ausrasten. Der Zuschauer leidet oder genießt mit, was an Erotik, Sex und destruktivem Hass in diesem mörderischen Spiel geboten wird. Und bekommt gleichzeitig die Grundlagen der Borderline-Pathologie nebenbei zum Nachvollziehen serviert. Denn gerade dieser Persönlichkeitstyp zeigt, wie schön es zuweilen wäre, ohne Triebverzicht sich auszuleben.
Auch der Blick auf den Regisseur offenbart, nach Kohrs, unbewusste Abwehrmechanismen, die aus deren leidvoller Kindheitserfahrung herzuleiten seien könnten. Das klinge reizvoll, doch sei es im Grunde genommen ethisch verpönt (welcher Regisseur will schon auf seine eigenen Schwächen hingewiesen werden). So gäbe es Wissenschaftler, die über den Zusammenhang von biografischem und filmischem bei Alfred Hitchcock nachdächten. Möglich sei etwa seine filmisch gezeigte Feinseligkeit gegenüber Frauen, deutlich werdend in den kläglich unterwürfigen Positionen männlicher Protagonisten gegenüber Frauen – resultierend aus der eigenen leidlichen Erfahrung? Wer denkt da nicht an das Mutter-Sohn-Dilemma in „Psycho“, berühmt geworden durch den Hauptdarsteller Anthony Perkins. Schüchterner Junge mit jähzorniger Mutter – Norman sei ein hin- und hergerissener Charakter zwischen Schüchternheit, Zorn, Aggression und bedingungslosem Hass, dann wieder zur Unterwürfigkeit zurückkehrend. Diese Gefühlsschwankungen den Eltern gegenüber sind vielleicht bei manchen Zuschauern nachempfindbar, können aber nur filmisch stellvertretend ausgelebt werden.
Auch J.R.R. Tolkien, der Autor von „Herrn der Ringe“ verarbeite, so Kohrs, den Verlust beider Eltern und die eigene Odyssee durch Waisenheime durch eine erdachte Mythologie einer archaischen Vorzeit mit idealisierter Kindheit und eigener Sprache der Protagonisten. Der wunderbare Film mit überwältigend phantasievoller Gestaltung könne im psychoanalytischen Sinne den Selbstheilungsversuch der Seele des Autors verständlich machen. Für den Zuschauer kann dies bedeuten, an den sehnsuchtsvollen Ort der einmal gelebten und unwiederbringlich entfernten Kindheit zurückzukehren oder diese in der Phantasie anders zu gestalten, als es die enttäuschende Realität vermochte.
Mit weiteren zahllosen Beispielen belegt Kohrs, dass jenseits des expliziten Filmnarrativs durch Interpretationen von Filmen und freie Assoziation, innerpsychische Vorgänge (Verdichtung, Verschiebung oder Spaltung) freigelegt werden könnten, die an primärhafte Prozesse anknüpfen. Emotionen, die vielleicht im Unbewussten schlummern und im „Sekundärprozess“ verleugnet oder verdrängt werden müssen, weil sie uns so ungeheuerlich erscheinen.
Und genau dies haben somit Traum und Film gemeinsam: in beidem geht es um unbewusste Botschaften, um Emotionen, Ängste, Gefühle, die wir nachempfinden wollen oder können, oder auch nicht, die uns in ihren Bann schlagen oder abstoßen, die aber dabei helfen, uns selbst besser zu verstehen – und genau damit arbeiten gute Autoren, Filmemacher und Regisseure.
Warum könnten wir dann nicht auch die unerwünschte Vergangenheit loslassen, selbst zum „Macher unserer Empfindungen“ im Alltagsleben und ein Stück weit in unseren Träumen werden? Schreiben Sie mir bitte Ihre eigenen Filmerlebnisse und ihre Gedanken dazu!
Danke für die filmischen Impressionen von Mohamed Hassan auf Pixabay!